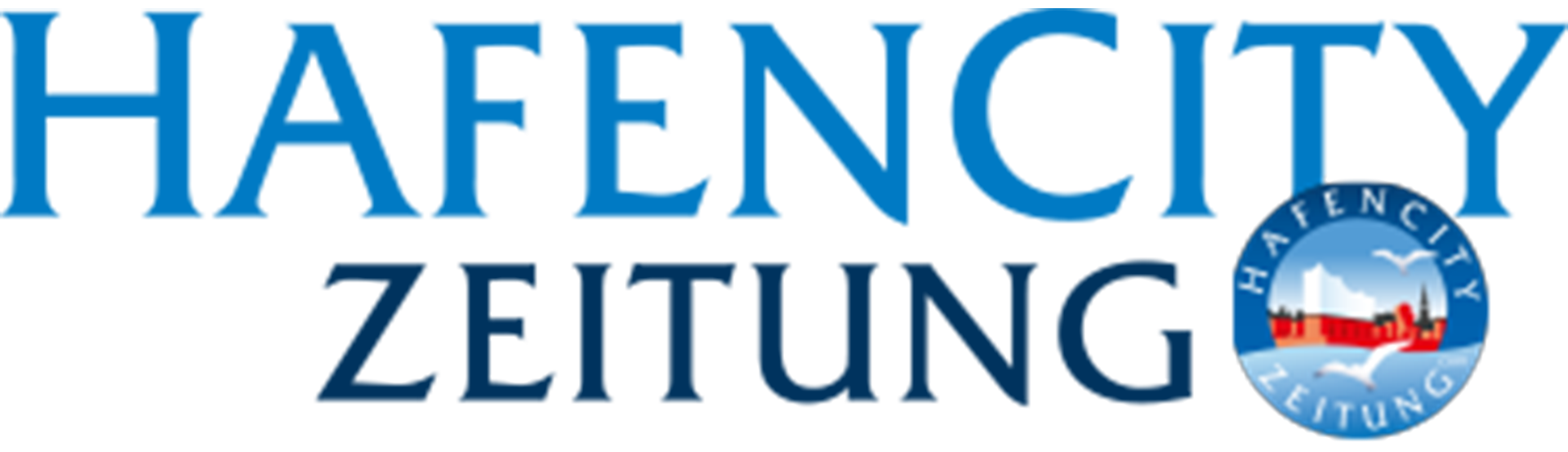Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Josef Höing sprach mit HCZ-Chefredakteur Wolfgang Timpe über Geschmack, Stadträume und Spaß am Amt
Herr Höing, Sie haben einen der kreativsten Jobs in Hamburg. Doch Ihre Amtsbezeichnung Oberbaudirektor klingt leicht bürokratisch und etwas verstaubt. Was sind Ihre Aufgaben? Für mich wirkt diese Bezeichnung weder verstaubt noch zu technokratisch. Mit dem Titel, von dem ich nie geahnt habe, ihn mal führen zu dürfen, kann ich wunderbar leben. Im Gegenteil, die Bezeichnung dokumentiert auch, dass es eine Instanz gibt, die sich um die Stadtentwicklung kümmert. Der Oberbaudirektor sollte einerseits eine Idee von der Gesamtstadt haben und andererseits aber auch die fachliche Fähigkeit besitzen, sich dann ums Detail zu kümmern, wenn es Sinn macht.
Foto oben: Hamburgs Oberbaudirektor: „Es geht mir vordergründig nicht um einen bestimmten architektonischen Stil und Materialitäten. Es geht vielmehr um die Fähigkeit, sich auf einen Ort einzulassen und ihn zu verstehen und daraus dann ein Projekt zu machen.“ ©Thomas Hampel
Sitzen Sie denn in Konferenzen und Diskussionsrunden, analysieren, beraten und entscheiden dann? Wie sieht eigentlich Ihre tägliches Kerngeschäft aus? Der Oberbaudirektor sitzt, steht oder rennt manchmal und kennt ganz unterschiedliche Aggregatzustände. Ich berate Bauherren und muss öfter auch zwischen unterschiedlichsten Positionen vermitteln. Unsere großmaßstäblichen und komplexen Zusammenhänge vom Bauen müssen gegenüber Planern und Architekten, den Fachleuten und eben auch der Politik erklärt werden. Oder ich muss für Themen werben und sie auf die Tagesordnung heben, weil ich sie für die Entwicklung der Stadt für relevant halte. Dazu gehören ebenso große öffentliche Veranstaltungen, bei denen wir mit den Bürgern in die Diskussion gehen.

wo man möglichst große Vielfalt organisiert hat, ohne dass es miteinander
etwas zu tun bekommen hat.« ©Thomas Hampel
Wie jüngst bei der Stadtwerkstatt über den neuen künftigen Stadtteil Grasbrook im Kreuzfahrtterminal der HafenCity. Ein spannender Ort, direkt an der Elbe, wo wir nicht im stillen Kämmerlein Pläne entwickeln, die wir dann einer Öffentlichkeit präsentieren, sondern die Hamburgerinnen und Hamburger von Beginn an mitnehmen. Dabei wollen wir nicht nur die Menschen überzeugen, dass unsere Ideen und Pläne richtig sind, sondern die Ideen der Menschen, der Anwohner oder künftigen Bewohner mit in diesen Prozess einfließen lassen. Darüber hinaus müssen auch die Aufgaben der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen erklärt werden, etwa wenn es um Stellungnahmen zu konkreten Bauvorhaben geht. Bei wichtigen, für die Stadt relevanten Projekten hat der Oberbaudirektor auch Entscheidungsbefugnis.
Insofern bestimmen Sie wesentlich das Stadtbild mit? Ja, doch ich habe keine Allmachtsphantasien und bin auch nur ein Rad im Getriebe der Entscheidungsprozesse. Meine Rolle ist einerseits schon, bei der Grundsatzfrage mitzuentscheiden, ob wir an einem bestimmten Ort stadtplanerisch Entwicklungen zulassen oder nicht. Andererseits bin ich mitverantwortlich für die Umsetzung städtebaulicher Entscheidungen und Vorgaben, zum Beispiel wie Häuser in einer bestimmten Umgebung auszusehen haben. In meiner Rolle ist es wichtig, die Aufgaben präzise zu formulieren und den Rahmen für Investoren, Projektentwickler und Architekten genau abzustimmen und auch die Auswahl mit zu prägen, welche Architekten man für das jeweilige Projekt für geeignet hält. Und am Ende bin ich auch in den Jurys, die sich für einen Siegerentwurf von Architekten und Landschaftsplanern entscheiden.
Franz-Josef Höing ist Stadtplaner und seit zwei Jahren Oberbaudirektor in der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen der Freien und Hansestadt Hamburg. Der 54-Jährige übernahm die Aufgabe von seinem Vorgänger Jörn Walter, der das Amt 18 Jahre lang ausübte und bei dem Höing vier Jahre lang als persönlicher Referent gearbeitet hat. Der Münsterländer, geboren in Gescher / Nordrhein-Westfalen, studierte Raumplanung an der Universität Dortmund und war dann Assistent am Institut für Städtebau und Raumplanung der Technischen Universität Wien.
Nach Stationen in Bremen als Senatsbaudirektor (2008-2012) und in Köln als Dezernent für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Verkehr (2012-2017) übernahm er am 1. November 2017 die Aufgabe in Hamburg. Franz-Josef Höing wohnt in Hamburg-St. Georg.
Das heißt Sie achten auch darauf, dass Querdenker und positive Spinner mit in die Mischung der Architektenauswahl kommen? Mit den „Spinnern“ habe ich es nicht so. Aber natürlich schaue ich in meiner Rolle als Verantwortlicher für die Entwicklung der gesamten Stadt heraus auch darauf, wo es interessante Büros für unsere Aufgabenstellungen gibt.
Wo schauen Sie da? Nicht nur in Hamburg und Deutschland, sondern in ganz Europa. Wir überprüfen auch immer wieder, mit welchen Städten wir uns messen wollen. Im Moment gibt es die spannendste Szene u.a. in London und in der Schweiz, aus der wir auch immer wieder einzelne Planerinnen und Planer einladen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir die Zusammensetzungen der Teilnehmerfelder etwas erweitert.

einfach nur verwalten. Hamburg will gestaltet werden und das muss man
mit vollem Einsatz leisten.« ©Thomas Hampel
Warum? Nicht, weil ich mich von meinem Vorgänger angestrengt emanzipieren will, sondern es gibt einen Generationenwechsel und neue spannende Köpfe bei den Städtebauern, Stadtplanern, Freiraumplanern, Architekten und Ingenieuren. Die Auswahl folgt dem jeweiligen Projekt.
Was finden Sie an der Szene in London oder in der Schweiz oder auch hier spannend? Mir liegt das sogenannte kontextuelle Entwerfen am Herzen.
Was meinen Sie damit? Dass man nicht mit dem immer gleichen Rezept an die unterschiedlichsten Orte herangeht, sondern vielmehr genau schaut, was einen Ort ausmacht. Wo sind Prägungen deutlich, die ich für ein neues Gebäude oder ein neues Quartier aufnehmen, übersetzen kann? Das treibt mich um. Dabei geht es mir vordergründig nicht um einen bestimmten architektonischen Stil und Materialitäten. Es geht vielmehr um die Fähigkeit, sich auf einen Ort einzulassen und ihn zu verstehen, und daraus dann ein Projekt zu machen.

Jahrzehnt herausragende Häuser hervorgebracht. Das muss jetzt auch
unser Anspruch in Hamburg sein« ©Thomas Hampel
Die Politik gibt in dieser Stadt vor, dass jährlich 10.000 neue Wohnungen entstehen sollen. Kann man das architektonisch gelungen und nachhaltig organisieren? Zunächst einmal finde ich gut, dass sich die Politik ehrgeizige Ziele vornimmt. In anderen Städten werden Sonntagsreden gehalten, man beklagt, dass zu wenig gebaut werde, der Nachfragedruck so groß sei und die Preise so stark steigen würden. Der Hamburger Senat und die Bezirke haben sich zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt dazu bekannt hat, dass Bauen eine stadtentwicklungspolitische Dimension hat. Hamburg hat dies mit Förderungen und Prozessoptimierungen flankiert und zudem die gesamte Verwaltung hinter diesem Ziel versammelt. Nicht nur etwa für ein Jahr, sondern mit großer Kontinuität.
Und auch mit kreativer architektonischer Qualität? In Hamburg wird solide gebaut und im Vergleich zu anderen Städten durchaus vorzeigbar. Mir ist bei all den imposanten Zahlen,10.000 genehmigte Wohnungen jährlich und davon 3.000 Sozialwohnungen, besonders wichtig, dass es immer auch um Qualität geht. Dazu sind wir u.a. in Diskussionen mit den Genossenschaften.
Meiner Meinung nach sind wir heute noch zu eng am Bekannten. Eine Stadt mit fast zwei Millionen Einwohnern ist immer gut beraten, ein breites Spektrum unterschiedlichster Wohnangebote bereitzuhalten. Die Vorstellungen, wie man in einer Großstadt wohnen möchte, sind äußerst unterschiedlich. Das können wir nicht allein mit Standardgrundrissen und in Förderrichtlinien hinein konzipieren. Da würde ich mir ein wenig mehr Experimente wünschen.
An was denken Sie da? Erst einmal an Fragen. Ist es richtig, dass die Quadratmeterzahl pro Bewohner immer noch ansteigt? Welcher Ausstattungsstandard ist der richtige? Welches sind künftig die zeitgemäßen Grundrisstypologien, die die vielfältige Stadtgesellschaft abbilden? Da haben wir noch eine richtige Wegstrecke zu gehen und sollten künftig neue Antworten finden.
Auch wie dicht die Bebauung in einer Metropole sein darf? Ja. Wie hoch und wie dicht darf ich an welcher Stelle in der Stadt bauen? Da gibt es keine Patentlösung für alle Stadtteile. Wichtig ist, das richtige Maß zu finden. Wobei man sagen muss, dass in den zentralen Lagen in Hamburg fast alle Flächen entwickelt sind. Deshalb bewegen wir uns langsam immer weiter nach außen: Wir haben das Thema Magistralen angestoßen und wie man dort Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität vielleicht neu beantworten kann. Wir kümmern uns um die stark begrünten Siedlungen der 50er und 60er Jahre, die man baulich weiterentwickeln und sanieren muss. Und es gibt Rahmenkonzepte für den Hamburger Osten mit seinen Industrie- und Brachflächen sowie vorhandener Bebauung und autoorientierter Infrastruktur.
Sie sind ein Befürworter von Magistralen, mehrspurigen Straßen in die Stadt, die nicht nur Autotransitraum sind, sondern auch Lebensqualität bieten sollen. Hand aufs Herz: Möchten Sie an einer Magistrale wohnen? Bei vielen Aufgaben stelle ich mir schon die Frage, würde ich da wohnen oder arbeiten wollen. Man hat ja ein eigenes Koordinatensystem im Kopf, an dem man misst, was man vor Ort sieht. Ich möchte die Magistralen zu einem lebendigen Teil der Stadt machen und sie nicht weiter zu transitorischen Räumen verkommen lassen. Wir haben ja schon vitale Großstadt-Varianten von Magistralen in Hamburg, während andere Ecken im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder gekommen sind. Und die haben wir in den vergangenen Jahrzehnten nicht mit der planerischen Sorgfalt behandelt, wie das erforderlich gewesen wäre und für zentrale Lagen selbstverständlich wäre. Da haben wir mit zweierlei Maß gemessen und damit will ich mich so nicht abfinden.
Bei der Vorstellung neuer Planungen über den Stadteingang Elbbrücken wurden auch neue Verkehrsideen präsentiert. Die berühmten „Autobahnohren“ hinter den Elbbrücken in Rothenburgsort haben Planungsbüros in einem Wettbewerb verschwinden lassen. Eine realistische Sicht auf weniger Autoverkehr in der Großstadt der Zukunft? Natürlich kann man nicht von heute auf morgen einfach einen Knopf drücken, und dann gibt es keinen Individualverkehr in der Großstadt mehrMan braucht einen langen Atem und muss ganz nüchtern darauf schauen, an welcher Stelle der Stadt man wie viel Verkehr haben möchte. Wo hat der Individualverkehr und wo haben andere Mobilitätsangebote Vorrang? Am Stadteingang wird auch meiner Meinung nach manche Verkehrsinfrastruktur aus den 60er und 70er Jahren nicht mehr gebraucht. Rothenburgsort erhielte so die Chance, an einer prägnanten Stelle wieder ein Gesicht zu bekommen und sich baulich weiterentwickeln zu können.
Mit welchen Maßnahmen kann die Verkehrswende gelingen? Es muss konkret in die Infrastruktur investiert werden: Wir müssen das U-Bahn-Netz ausbauen, offensiv den Busverkehr in der Stadt weiterentwickeln und stärker auf den Radverkehr setzen. Die Stadt muss Alternativen schaffen. Immer nur zu drohen, dass man etwas verbietet oder nicht mehr möglich macht, reicht nicht aus. Und da ist Hamburg mit seiner neuen U4 und einer komplett neuen U5 und anderen Maßnahmen auf einem guten Weg. Parallel dazu kann man dann auch über weniger Verkehr und Parkraum in der Innenstadt sprechen.
Einiges davon wie die U4 ist in der HafenCity umgesetzt worden. Sie waren ab 2003 unter Oberbaudirektor Jörn Walter Leiter der Projektgruppe HafenCity. Sind Sie mit Ihrem Projekt zufrieden? Ich war mal der persönliche Referent von Jörn Walter und durfte hier in der Behörde die Projektgruppe HafenCity leiten. Weder ist es mein Projekt, noch möchte ich mir fremde Federn an den Hut stecken. Zwar habe ich jetzt mit einzelnen Themen wieder zu tun, aber in fünf, sechs Jahren wird die HafenCity baulich weitgehend fertig sein. Dass es in Europa kein einziges Projekt gibt, das überzeugender ist als die HafenCity, ist nicht das Verdienst eines kleinen Referenten, sondern das Verdienst meines Vorgängers und der der HafenCity Hamburg GmbH.
Was ist gelungen, was Sie damals schon in ihrer Projektgruppe erörtert haben? Maß zu halten und den richtigen Maßstab zu finden mit Gebäudehöhen, öffentlichen Räumen und Grünanlagen. Die HafenCity orientiert sich, und das meine ich als Lob, an einer traditionellen Vorstellung von Stadt: mit lesbaren Stadträumen, mit Straßen, Parks und Plätzen. Es ist im besten Sinne ein Stück europäische Stadt unter heutigen Rahmenbedingungen entstanden. Und bis auf wenige Häuser wie die Elbphilharmonie, das Spiegel-Gebäude oder die HafenCity Uni – besondere Orte die auch eine besondere Architektur bekommen haben – ist die Architektur zwar wichtig, aber ist sich nicht selbst genug. Es geht immer um den Kontext, geht immer darum, lesbare Stadträume entstehen zu lassen. Die HafenCity ist kein architektonischer Streichelzoo geworden, wo man möglichst große Vielfalt organisiert hat, ohne dass es miteinander etwas zu tun bekommen hat. Zum Beispiel hat man immer daran festgehalten, die Hafenbecken zu wichtigen Plätzen in der Stadt zu machen. Rund um den Magdeburger Hafen sind alle Gebäude rot, weil man über das Material einen zusammenhängenden Stadtraum definieren wollte Und an der Elbe hat man eine helle, fast weiße Stadt. Es ist kein Zufall, dass sich die Menschen in der HafenCity wohlfühlen und die Promenaden belebt sind.
Trotzdem stören sich viele Anwohner an einem fehlenden Radwegkonzept und an zu wenig Grün. Bei den Radwegen muss man noch einmal mit einem anderen Blick hinschauen und an der einen oder anderen Stelle nachbessern. Aber in Bezug auf die Freiräume teile ich Ihre Kritik nicht, denn in der HafenCity ist ein breites Spektrum an öffentlichen Plätzen entstanden: nicht nur klassische Parks wie zum Beispiel der Lohsepark, sondern auch Promenaden oderTreppen und Plätze.
Und was antworten Sie den Kritikern, die die Gebäude der HafenCity zu gleichförmig, zu würfelig finden? Auch diese Kritik teile ich nicht. In der HafenCity gibt es eine große architektonische Vielfalt. Dabei kommt es mir nicht so sehr auf das einzelne Gebäude an, sondern darauf, dass diese Einzelgebäude in Summe einen Kontext entstehen lassen.Es ist einerseits eine gelungene Mischung aus einzelnen Häusern und Straßenzügen mit eigenem Charakter entstanden und andererseits hat man das Gefühl, sich durch einen zusammenhängenden Stadtraum zu bewegen.
Und das ist in anderen Metropolen Europas nicht so? Nein. Fahren Sie mal durch Europa und schauen Sie sich die neuen Stadterweiterungsgebiete mit der Kakophonie von Häusern und Architekturen an. Da hat Hamburg vieles richtig gemacht.
Braucht Hamburg Hochhaus-Leuchttürme wie den Elbtower für ein modernes Gesicht? Es gibt wenig Stellen, wo Hamburg hohe Häuser braucht und vertragen kann. In den zentralen Stellen der Innenstadt kann ich mir keine Hochhäuser vorstellen. Man muss die Stadtsilhouette wahren und sehr sorgsam mit ihr umgehen. Aber ein Ort mit großem Stadt- und Flussraum wie beim Elbtower verträgt einen anderen Maßstab. Und zugleich haben wir mit der U4-Linie und der bald fahrenden S-Bahn höchste Zentralität hergestellt. Da kann man, mit gehörigem Respektabstand zur historischen Innenstadt Hamburgs, dicht und hoch bauen. Auch im östlichen Baakenhafen, dem Elbbrückenquartier, entstehen einige höhere Häuser.
Prominente, wie etwa der Schriftsteller Boris Meyn, finden „dass Hamburg solche Phallussymbole wie den Elbtower“ nicht nötig habe. Jeder kann seine Meinung haben. Für mich wird da keine reine Präpotenz zur Schau gestellt. Das ist ein großer erschlossener Landschaftsraum und da kann man auch mal hoch bauen.
Jörn Walter, Ihr Amtsvorgänger, hatte nach 18 Jahren als Oberbaudirektor fast Legendenstatus. Wie groß waren die Stiefel, die Sie als Nachfolger anziehen mussten? Man hat natürlich Respekt vor diesem Amt. Ich habe nie gedacht, dass ich einmal Oberbaudirektor in Hamburg werden dürfte. Aber ich bin auch nicht wochen- und monatelang in Ehrfurcht erstarrt. Ich war vorher Baudezernent in Köln und nicht unzufrieden, aber ich wollte diese einmalige Chance in einer tollen Stadt nutzen. Außerdem, das ist kein Geheimnis, habe ich ein freundschaftliches unverkrampftes Verhältnis zu Jörn Walter.
Sie waren auch vier Jahre lang von 2000 bis 2004 sein Referent. Was haben Sie von ihm gelernt? An Jörn Walter bewundere ich, dass er sich seinen Aufgaben mit Leidenschaft und mit aller Kraft widmet. Als Oberbaudirektor können Sie nicht ihren Job oder die Stadt einfach nur verwalten. Hamburg will gestaltet werden und das muss man mit vollem Einsatz leisten. Das hat Jörn Walter immer vorgelebt – neben all den fachlichen Fähigkeiten, von denen ich mir das eine oder andere abgeschaut habe. Darüber hinaus hat er eine unglaubliche Geduld und ein unglaubliches Verständnis für die unterschiedlichen Rollen, die es in einer Stadt gibt. Ich hoffe, dass seine Art auf mich ein wenig abgefärbt hat: Uneitelkeit und Bescheidenheit gegenüber dem Amt und der Stadt. Man soll sich selbst auch nicht zu wichtig nehmen.
Sie sind in Gescher bei Münster geboren. Wie kommt man als katholischer Westfale in Hamburg klar? Mental sind das Münsterland und das Norddeutsche nicht so weit voneinander entfernt.
Und was ist mit Ihren katholisch-barocken Anteilen? Die wurden eher im Rheinland und in Köln angesprochen, wo alles etwas überschwänglicher und lockerer ist. Das Münsterland steht eher für Sachlichkeit und Verlässlichkeit.
Und wo wohnt Hamburgs Oberbaudirektor? Weil der Wechsel ziemlich unverhofft von Köln nach Hamburg kam, wohne ich in einer kleinen Wohnung in St. Georg unterm Dach. Und die sehe ich manchmal erst spät abends, wenn ich nach Abendterminen nach Hause komme., Mit der S-Bahn bin ich mit wenigen Stationen im Büro. Ich bin froh, so gut angebunden zu sein.
Sind Sie eher ein Altbau- oder Neubautyp? Ehrlicherweise habe ich darüber noch nie nachgedacht.
Wo halten Sie sich in Hamburg am liebsten auf, wenn Sie nicht zuhause sind? In diesem Zimmer, in meinem Büro (lacht herzlich).
Das fände Ihr Hausarzt bedrohlich. Ich mag das gerne, hier zu sein und den Dingen nachzugehen. Als Oberbaudirektor sollte man auch nicht ewig zwischen Privatem und Beruflichem trennen. Ich mag es, meine Aufgabe mit Haut und Haaren auszufüllen. Und ich bin gerne in der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen mittendrin in Wilhelmsburg, wo die Stadt noch nicht ganz fertig ist.
Sie haben Raumplanung an der Uni Dortmund studiert und waren Assistent an der technischen Uni Wien. Sind Sie eigentlich eher Stadtplaner oder Architekt? Ich bin kein ausgebildeter Architekt und auch kein klassischer Stadtplaner, sondern habe mich immer für Städtebau, für die bebauten Räume interessiert. Auch wenn ich nie Häuser gebaut habe, maße ich mir ein gewisses Urteilsvermögen an.
Gibt es in Hamburg oder der Welt ein Bauwerk, das Sie vorbehaltlos fasziniert? Da gibt es nicht eins, sondern hunderte – und man muss nicht einmal die Stadt verlassen. Die Elbphilharmonie ist für mich schon, auch auf die nächsten Jahre gesehen, ein magisches unglaubliches Haus geworden.
Nix in Europa? Na gut, in Köln hat mich der Dom wirklich mehr als beeindruckt. Und als ich jüngst in Paris war, war ich erstaunt, dass das Centre Pompidou, das Jahrzehnte auf dem Buckel hat, nach wie vor mitten in der Stadt ein besonderer Ort ist. Mit einer Architektur, die immer noch modern und technoid in ihrer äußeren Anmut ist;eine Kulturmaschine, die zur Lebendigkeit der Stadt beiträgt. Eigentlich hat von der Nachkriegszeit bis heute jedes Jahrzehnt herausragende Häuser hervorgebracht. Und das muss jetzt auch unser Anspruch in Hamburg sein.
In Hamburg arbeiten Sie für die SPD-Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt und Leiterin der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Sie sind parteilos. Ist Ihnen das wichtig? Ich bin Stadtplaner, Städtebauer und Oberbaudirektor und bin das nicht für eine Partei, sondern für die ganze Stadt. Ich begreife mich als Anwalt der Stadt und Anwalt der Interessen aller Bürgerinnen und Bürger. Das macht einen an manchen Stellen neutraler und glaubwürdiger. Ich habe mich aus den politischen Dingen nie herausgehalten, mir war es aber immer wichtig, die Fachlichkeit nach vorne zu bringen. Und das hat mir bis dato nicht geschadet – ganz im Gegenteil.
Sie haben öfter mal betont, dass Sie diese Stadt besser machen wollen. Wo und wie? Es gibt zwei schöne Überschriften: Die erste ist „mehr Stadt in der Stadt“, was wir zum Beispiel mit dem Grasbrook in konkrete Projekte übersetzen Und das zweite Beispiel ist die Science City in Bahrenfeld, ein Ort, von dem man schon geglaubt hatte, dass die Stadt hier fertig gebaut ist. Jetzt haben wir dort die Chance , ein neues Stadtquartier mit der Überschrift „für die Wissenschaft ein Zuhause“ entstehen zu lassen.
Ihr Vertrag läuft noch neun Jahre bis 2028. Was muss bis dahin geschehen, damit Ihre Amtszeit erfolgreich gewesen sein wird? Alles, was wir zurzeit machen, soll umgesetzt werden und zu Verbesserungen vor Ort führen. Natürlich braucht man in meiner Rolle einen langen Atem. Neun Jahre sind nicht lang für städtebauliche Projekte, obwohl es erst einmal lang klingt. Der Architekturkritiker Michael Mönninger hat einmal gesagt: „Zwischen dem Blitz des Entwurfs und dem Donner der Baustelle vergeht ziemlich viel Zeit.“
Was macht Ihnen als Oberbaudirektor eigentlich am meisten Spaß? Die größte Freude besteht darin, etwas auszubrüten und dann andere Leute dafür zu gewinnen. Kleine Dinge, die am Küchentisch oder hier am Schreibtisch entstehen – wie etwa das Magistralen-Thema oder die Reaktivierung des Formats Bauforum. Das finde ich beglückend, weil man das in dieser Rolle als Oberbaudirektor auch machen kann.
Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit? Für jedes einzelne Projekt hätte ich gerne mehr Zeit, weil eine Flut von Dingen parallel läuft, die bearbeitet werden müssen. Nur selten habe ich Zeit, um mal einen Tag länger über die eine oder andere Sache nachzudenken.
Welche drei Dinge machen Ihr Leben schöner? Es gibt immer kleine Phantasien, wie etwas noch schöner sein könnte. Aber ich sage das jetzt ohne Koketterie: Wenn sich einer nicht beschweren darf und einen Traumjob hat, dann bin ich das. Bei allen Anstrengungen und Herausforderungen ist es ein unglaubliches Privileg, Oberbaudirektor von Hamburg sein zu dürfen. Das sage ich nicht, weil sich das so gehört, sondern weil ich es so empfinde.
Das Gespräch führte Wolfgang Timpe