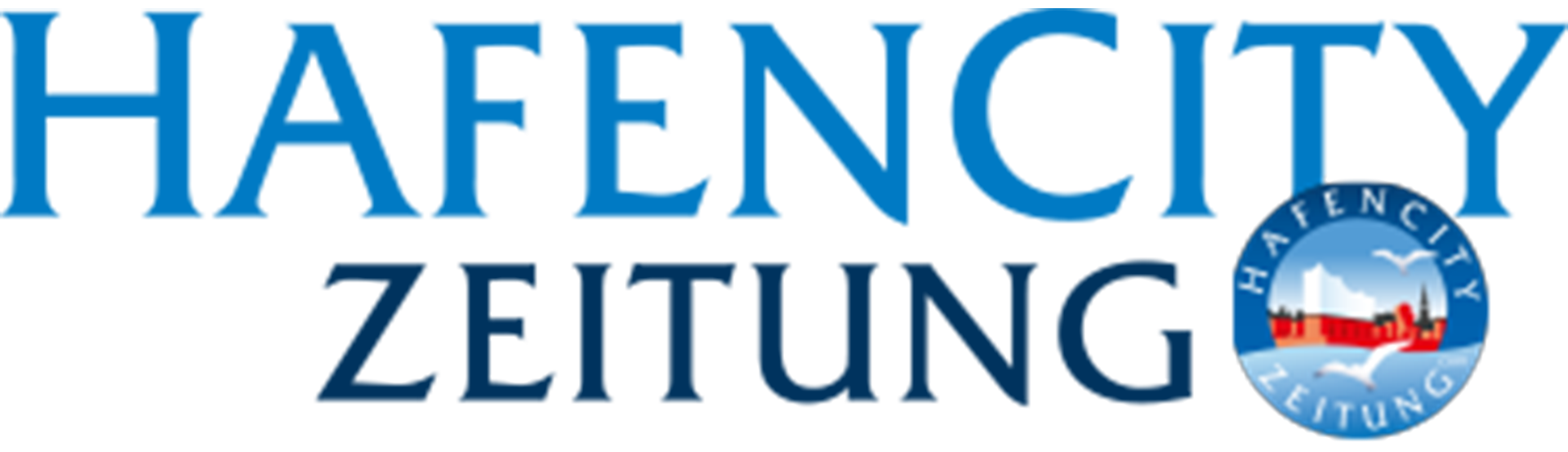Und tschüss. Er war Immobilen- und Grundstücksexperte, Bauherr und Stadtentwickler, Architekten- und Landschaftsplaner-Scout sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity GmbH. Nun ist am 31. Oktober nach 18 Jahren Schluss. Ein Zukunftsgespräch
Herr Bruns-Berentelg, Sie haben in den 90er Jahren für internationale Immobilienunternehmen gearbeitet, u.a. am Bau des Sony-Centers am Potsdamer Platz in Berlin mitgearbeitet, und zuletzt über 18 Jahre lang als Chef die HafenCity entwickelt und bauen lassen. Sie mussten Politik, Verwaltungen, Investoren, Stadtplaner und Architekten sowie Initiativen von Konzepten und Projekten überzeugen. Sind Sie ein Dealer? Nein. Man muss für diese berufliche Tätigkeit zwei Dinge aufweisen: Einerseits eine sehr langfristige und komplexe Perspektive, aus der heraus man mit Überzeugung, Qualität und Ambitionen Stadt entwickelt. Insofern war das eine Kernqualität, die ich für mich in Anspruch nehmen möchte. Das Zweite, das ich für mich in Anspruch nehmen möchte, ist die Qualität, aus den Möglichkeiten, die sich aus den langfristigen Perspektiven und Möglichkeiten ergeben, Chancen für einzelne Projekte zu entwickeln und auch strategische Entscheidungen immer im Sinne der urbanen Qualität, der Nachhaltigkeit und der sozialen Qualität der Stadtentwicklung zu treffen. Daraus ergibt sich vielleicht auch eine Deal-Making-Kapazität.
Foto oben: Nach 18 Jahren Quartierbauen und -entwickeln, empfiehlt der HafenCity-Chef Prof. Jürgen Bruns-Berentelg den Anwohner:innen, immer schön in Bewegung zu bleiben: „Zeigen Sie, auch wenn es manchmal nicht einfach ist, den Optimismus und die Überzeugung, die notwendig sind, um Stadtzukunft zu gestalten. Die HafenCity ist nie fertig.“ © Foto: Bina Engel

Aber Sie haben 2003 nicht die HafenCity vor Augen gehabt, wie sie heute ist? Keiner hat sich die HafenCity in dieser physischen und sozialen Form vorstellen können, obwohl wir immer die europäische Stadt des 21. Jahrhunderts im Kopf hatten. Man kann immer nur eine Rohversion dessen, was entsteht, imaginieren. Man muss sich die Qualitätskriterien und Ambitionen immer wieder neu vorleben. Dann entwickelt sich im Realisierungsprozess das jeweils Beste, das man erreichen kann.
Welches ist Ihre Qualität, mit der Sie unterschiedlichste Partner und Interessen ins Boot geholt haben? Man muss sehr langfristig denken wollen und eine Stadt für 100 Jahre bauen. Vielleicht ist das Teil meiner Persönlichkeit, weil ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin und dort gelernt habe, in sehr langfristigen Perspektiven zu denken. Sie arbeiten immer für die nachfolgende Generation, für die Enkel und nicht für den nächsten Tag. Die zweite Kernqualität ist: Ich habe das Glück gehabt, in meinem Studium sehr früh die Bandbreite von sehr intelligenter Stadtforschung kennenzulernen. Dadurch habe ich sehr früh eine Ader entwickelt zu den Themen Wohnen, soziale Integration, Beteiligungsprozesse und sehr früh in Projekten gearbeitet, wo ich schon als 22-Jähriger einem Baudezernenten einer Großstadt gegenübersaß.
Und ich hatte als Generalist immer eine akademische Außenperspektive, weil mein Studienfach ja nicht Architektur, Städtebau oder Juristerei war. Ich habe von all diesen verschiedenen Faktoren profitiert und ein gutes Gefühl für die notwendige Komplexität entwickelt und die richtigen Perspektiven und das Reagieren auf Anforderungen, die mir gezeigt haben, dass man weiterdenken muss. Und natürlich die beruflichen Erfahrungen aus der Immobilienwirtschaft aus wirklich großen Vorhaben.
Wir sind im Augenblick nicht in der Lage, alle Prozesse des Stadtbauens emissionsfrei darzustellen und Produkte emissionsfrei für klimaneutrale Stadtquartiere herzustellen. Das bedeutet kontinuierliche Anstrengungen.« Prof. Jürgen Bruns-Berentelg
Haben Sie eine Philosophie, denken Sie Projekte vom Ende her? Nein. Wenn man vom Ende her denkt, glaubt man, das Ende schon zu kennen. Das kann man nicht in der Stadtentwicklung. Man muss in Prozessen denken, in Entwicklungsphasen.
Sie haben mal gesagt: „Nach mehr als 18 Jahren ist mein Gestaltungsbedürfnis mit der HafenCity beendet.“ Das hört sich nach „genug ist genug“ an. Fehlt inzwischen die kreative Frische? Das bezog sich nur auf die HafenCity. Ich betreibe mit Ambitionen die Gestaltung des Grasbrooks, des Billebogens und der Science City Bahrenfeld. Gemeint war damit: Den Gestaltungsrahmen für die HafenCity haben wir längst festgelegt. Es entstehen allerdings einzelne, immer bessere Projekte.
Fast zwei Jahrzehnte drehte sich bei Ihnen alles darum, die wachsende Innenstadt Hamburgs am Wasser erfolgreich zu bauen. Wie kommen Sie jetzt zu einer neuen Lebensmitte, zu neuen Gedanken? Die Gedanken werden noch relativ lange um die HafenCity und die akademischen Erfahrungen daraus kreisen. Aber ich werde ab November meine wissenschaftliche Arbeit wieder verstärkt aufnehmen, die pandemiebedingt im vergangenen Jahr eingeschränkt war.
Die HafenCity Hamburg GmbH ist eine private Tochtergesellschaft der Stadt Hamburg. Lag der Erfolg darin, dass Sie immer genügend Beinfreiheit hatten? Es war sicherlich Teil des Erfolgs, dass uns genügend Raum gegeben wurde und insbesondere der Aufsichtsrat sich mit den fachlichen Meinungen auseinandergesetzt hat. Wir haben aber auch immer überzeugende Gründe gehabt, für das, was wir angestrebt haben. Die Freiräume, die ich gerade in den Anfangsphasen für die Entwicklung der HafenCity hatte, waren viel größer als das im Vorstand eines börsennotierten Unternehmens möglich gewesen wäre. Und es lag auch daran, dass es 2003, als ich anfing, noch eine Krisensituation gab, weil damals ein überzeugendes Konzept für den MediaCityPort rund um den Kaispeicher A fehlte, der dann abgelöst wurde durch die Elbphilharmonie. Insofern war jede Entwicklung, die in den Fokus der Qualitätsentwicklung und Realisierung der HafenCity passte, ein positives Signal für den damaligen Bürgermeister Ole von Beust. Das erste HafenCity-Vorhaben von mir angeregt, war übrigens die erfolgreiche Ansiedlung des Internationalen Maritimen Museums Hamburg von Peter Tamm am Magdeburger Hafen – nach langer Suche für einen guten Standort.
Haben Sie sich auf Ihren Abschied am 31. Oktober vorbereitet? Ich habe mich nicht darauf vorbereitet und werde aus einem vollen Terminkalender in den Ruhestand fallen. Am Tag meines Ausscheidens werde ich mich morgens früh hinsetzen und anfangen zu schreiben.
Sie sind verheiratet und haben einen erwachsenen Sohn. Ist Ihre Frau auf den Privatmann Bruns-Berentelg vorbereitet? Meine Frau und ich wollten erst einmal drei Monate verreisen, was Corona bedingt nicht möglich ist. Meine Frau hat jetzt ihre Berufstätigkeit als Lehrerin um ein Jahr verlängert. Also werde ich ihr nicht dadurch auf die Nerven gehen, dass ich zu Hause bin oder in einer Bibliothek sitze.
Wenn man eine solche Aufgabe übernimmt, hat man immer Erfahrungs- und Wissenslücken und man muss willens sein, diese auszufüllen und daran zu arbeiten. Stadt ist ein hochkomplexes Produkt, die bedeutendste Erfindung der Menschheit.«
Prof. Jürgen Bruns-Berentelg
Ihr elektrischer BMW i3 stand jahrelang morgens als erstes vor der HafenCity-Unternehmenszentrale und spätabends immer noch. Konnten Sie überhaupt abschalten und wenn ja, wodurch? Ich habe in den Morgenstunden immer auf die eine oder andere Weise Sport getrieben und bin ein fanatischer Leser. Und ich bin im Sommer mit meiner Frau gereist und habe dadurch sehr viele Stadtentwicklungsprojekte auf der ganzen Welt kennengelernt und dadurch viele Inspirationen für meine eigene Arbeit bekommen. Die fachliche Neugierde, wie Städte insbesondere am Wasser gebaut werden, hat mich immer begleitet. Insofern war ich immer mit Themen der HafenCity verbunden, ohne okkupiert zu sein. Aber es kommt vor, dass man mit einem Gedanken an ein Problem einschläft und am nächsten Morgen die Lösung näher ist.
Sie brauchen zum Einschlafen das Lesen und anregende Gedanken. Warum schlafen Sie nicht nach einer Seite ein? Ich lese relativ kurze Texte, wissenschaftliche Aufsätze. Halbe Bücher lese ich eher am Wochenende.
Sie hatten vor ein paar Jahren eine herausfordernde Herz-Krankheit und haben sich danach sportlich konsequent fit trainiert. Wie haben Sie Ihre berufliche und persönliche Disziplin erlernt? Ich habe früher schon sehr viel Sport gemacht, war Zehnkämpfer als Jugendlicher. Die sportlichen Aktivitäten haben mich immer begleitet.
Was hat Sie am meisten geprägt: das Elternhaus, das Studium oder das Arbeitsleben? Ich vermute alles. In meinem bäuerlichen Elternhaus habe ich früh gelernt anzupacken, dass Arbeit als soziales Verhältnis und langfristig gesehen werden muss. Das Studium hatten wir ja schon gestreift. Bei der Marine habe ich schnell gelernt, eine Führungsaufgabe wahrzunehmen. Das ist ein großes Geschenk mit 22 Jahren. Und das Arbeitsleben war insofern prägend, weil ich das Glück hatte, in Unternehmen mit hoher internationaler Reputation an großen Vorhaben arbeiten zu können. Rückblickend haben viele berufliche und persönliche Glücksfälle dazu geführt, dass ich diese Lebenserfahrungen für Hamburg nutzen konnte.
Haben Sie in diesen Phasen auch die notwendige Härte für die Führung eines Unternehmens erlernt? Ich bin, vermute ich, nicht zum Manager geboren und habe mir durchaus eine gewisse Härte angeeignet, weil ich eher am Konsens orientiert bin. Ich bin bereit, Laissez-faire zu dulden. Beispielsweise habe ich niemanden entlassen, als ich 2003 anfing und immer versucht, meine Mitarbeiter:innen in der HafenCity Hamburg GmbH inhaltlich bei steigenden Anforderungen mitzunehmen. Ob das erfolgreich war, müssen andere entscheiden. Es ist aber ein Indikator dafür, dass ich nicht die Härte habe, die Selektion zum wesentlichen Maßstab meines Erfolgs in den Projekten zu machen. Ich habe deshalb manchmal persönlich mehr gemacht, als man das tun sollte.
Würden Sie das heute wieder so machen oder würden Sie mehr delegieren? In der heutigen Größe können Sie diese Firma nicht mehr so persönlich führen, wie wir das getan haben. Leider betrifft das zum Beispiel auch den persönlichen Kontakt zu den HafenCity-Bewohnern, der für mich eine Inspiration und ein Prozess der Selbstkontrolle war.
Lassen Sie uns eine kurze Zeitreise zurück zu den Anfängen machen. 2003, als Sie HafenCity-Chef wurden, gab es die Idee der wachsenden Stadt Hamburg, erste Elbphilharmonie-Pläne, der Freihafen wurde abgewickelt und es gab nur das SAP-Gebäude (heute KLU) am großen Grasbrook – aber schon ein Symbol der neuen Stadt: die Kibbelstegbrücke von der Speicherstadt ins Nirwana, eine Verbindung zur geplanten HafenCity, dem heutigen Großen Grasbrook. Prägte Sie damals Euphorie des Schaffenwollens oder auch der Respekt vor der Überforderung, eine Stadt neu zu bauen? Nein, eine Überforderung war es nicht. Ich hatte ja die Gelegenheit, vorher schon an Großprojekten wie etwa dem Sony-Center in Berlin, aber auch in Projekten in New York zu schnuppern und erstmal Erfahrungen als Berater und Stadtentwickler zu sammeln. Das hat mir die Furcht genommen. Ich wusste immer: Vielleicht kenne ich die Lösung zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht, aber ich werde eine finden und bin fachlich kreativ genug dafür. Und ich war nie ängstlich, diese Lösung zu verfolgen.
Welche Ihrer Charaktereigenschaften waren mitverantwortlich für den Erfolg? Ein gewisses Maß an Ungeduld mit mir selbst, aber auch mit den Prozessen. Und zweitens ein großes Maß an Hartnäckigkeit und Ausdauer, wenn nicht die beste Lösung dann doch eine zweite oder vielleicht sogar eine ganz andere bessere Lösung voranzutreiben. Aufgeben gehörte im Interesse der langfristigen Ziele nicht dazu.
Bitte Farbe bekennen! Ihr Herzensprojekt in der HafenCity? (denkt lange nach) Für den Erfolg der HafenCity sind ein paar Entscheidungen wichtig gewesen: Einerseits die Elbphilharmonie, die ich nur in der Anfangsphase beeinflusst habe, und andererseits zwei Voraussetzungen: Dass eine U-Bahn und das südliche Überseequartier gebaut wurden. Das sind wichtige Wendepunkte, die andere Qualitäten nach sich gezogen haben. Die Summe der guten Entscheidungen und Entwicklungen ist in der HafenCity besonders hoch. Wenn ich einen Ort nennen soll, der zunächst nicht konzipiert war, aber besonders wichtig ist, dann ist das der Baakenpark, mit dem ich auch emotional verbunden bin (siehe Reportage S. 32).
Inwiefern? Wo hätten die Menschen in der östlichen HafenCity sonst ihren Ort haben sollen, an dem sie Freizeitaktivitäten im Grünen verbringen? Ich bin 2009/2010 heftig kritisiert worden für den Vorschlag einer grünen Insel als Freiraum. Aber am Ende war es eine richtige und wichtige Entscheidung, diesen Identifikationsraum für das Quartier dann mit einer tollen Planung von Loidl Landschaftsplanern zu schaffen und nicht nur Häuser zu bauen.
Wenn man mit Ihren Wegbegleiter:innen spricht, hört man immer wieder: „Er hatte die Strategie, sein Publikum so lange wissend zu reden, dass etwa Politik oder Investoren erschöpft ,Ja’ sagten“ und Sie dann Ihr Konzept durchziehen konnten. Stimmt das? Nein, es ist die Fähigkeit, die Ideen, von denen man überzeugt ist, auch zu kommunizieren und nicht auf die Ideen der Politik zu warten, sondern selbst intelligente Stadtentwicklung und Lösungen vorzuschlagen. Das ist nicht abhängig von Aufgaben und Beschlüssen. Ich habe beispielsweise schon 2004 mit Herrn Schultz-Berndt dafür gesorgt, dass wir Grundstücke zum Festpreis ausgeschrieben haben, damit Genossenschaften und Baugemeinschaften in die HafenCity ziehen können und eine gute soziale Mischung hergestellt werden kann. Das war bis dato nicht vorgesehen und ich bin froh, dass wir es gemacht haben und es positiv geduldet wurde, obwohl es zunächst nicht Programm war. Denn das hat wichtige Voraussetzungen geschaffen für einen Zusammenhalt in einem Stadtteil, der niemals nur ein Stadtteil der Reichen war.
Waren Sie jemals Mitglied einer Partei? Nein, nie. Ich habe das ganz bewusst vermieden, weil man dann in politischen Kategorien denken würde und nicht in Qualitätskategorien für langfristige Stadtentwicklung. Man kann nur erfolgreich so lange arbeiten und Moderator, Mediator sowie ein geschätzter Vorschlagender von Ideen sein, wenn man keine parteipolitische Bindung hat oder diese völlig vergisst. Das Denken von Möglichkeiten für Stadtqualität hat uns immer unabhängig von politischen Überzeugungen getragen. Deshalb waren wir oftmals den politischen Setzungen voraus. Anders kann man zeitgerecht die Umsetzung auch gar nicht schaffen. Das betrifft zum Beispiel die ständige Arbeit an einem verbesserten Mobilitätskonzept.
Was für ein Angebot muss kommen, damit Sie irgendwo auf der Welt noch einmal eine HafenCity bauen? Solch ein Angebot würde ich heute ganz sicher nicht mehr annehmen. Es hat kürzlich erst eins im Vorderen Orient gegeben. Aber die Entwicklungsmöglichkeiten, dort gute Stadt zu bauen, sind nahezu aussichtslos. Die Rahmenbedingungen sind so, dass sie letztlich auf ein Kunstprodukt hinauslaufen und das werde ich sicherlich nicht machen wollen. Aber es gibt mit der HafenCity-Stadtentwicklung und den neuen Stadtteilen, die weitgehend – bis auf die Science City Bahrenfeld – planerisch bestimmt sind, auch einen Abschluss meiner beruflichen Laufbahn.
Prof. Jürgen Bruns-Berentelg hat seit 2003 als Vorsitzender der Geschäftsführung die HafenCity Hamburg GmbH (HCH), die Stadtentwicklungsgesellschaft im Eigentum Hamburgs, über 18 Jahre lang geführt. Sie ist mit der Entwicklung des Stadtteils HafenCity, des Billebogens, des neuen Stadtteils Grasbrook und der Science City Hamburg Bahrenfeld betraut. Bruns-Berentelg, geboren und aufgewachsen auf dem elterlichen Landwirtschaftsbetrieb in Großenkneten im Landkreis Oldenburg, geht zum 31. Oktober in den Ruhestand und wird zum 1. November 2021 die Geschäfte an seinen Nachfolger Dr. Andreas Kleinau übergeben, der schon seit September 2020 mit in der HCH-Geschäftsführung ist. Und zum 1. November tritt auch die Kulturmanagerin und Betriebswirtin Theresa Twachtmann für den ebenfalls langjährigen HCH-Geschäftsführer Giselher Schultz-Berndt neu in die HCH-Geschäftsführung ein.
Jürgen Bruns-Berentelg hat nach dem Abitur am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Großenkneten und USA-Jobs eine Ausbildung zum Marineoffizier absolviert sowie Geografie, Biologie und später Immobilienökonomie studiert. Vor der Übernahme des City- und Waterfront-Entwicklungsprojekts HafenCity war der 70-Jährige in leitenden Positionen bei britischen, amerikanischen und deutschen Immobilienunternehmen tätig und war u.a. am Bau des Sony-Centers am Potsdamer Platz in Berlin beteiligt. 2014 wurde er zum Professor (hc) für Integrierte Stadtentwicklung an der HafenCity Universität Hamburg ernannt. Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene hält er Vorträge zu Themen innovativer Stadtentwicklung und publiziert regelmäßig. Jürgen Bruns-Berentelg ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und lebt in Hamburg.
Welches war Ihr größter Fehler? Wahrscheinlich habe ich eher viele kleine Fehler gemacht und nicht einen wirklich großen. Wenn man heute den Kaiserkai entlanggeht, sieht man, dass die Tiefgarageneinfahrten zu dominierend sind und den Blick auf das Wasser verstellen oder dass es Gebäude gibt, die keine gewerbliche Erdgeschossnutzung haben. Das würde man heute nicht mehr zulassen. Solche Dinge sieht man heute im selbstkritischen Umgang. Aber es ist kein wesentlicher Fehler gemacht worden. Natürlich haben wir den Grasbrook viel ambitionierter geplant als die HafenCity. Aber niemand wäre einer solchen Planung im Jahr 2000 gefolgt.
Ich habe Sie anno 2019 als leidenschaftlichen Stadtplaner erlebt, der wütend auf die Politik schimpfte, die ihm mit dem Masterplan die Autostadt HafenCity mit 4-spurigen Straßen verordnet hatte – als Transitstrecke in die Innenstadt. Ist das die stärkste Wunde im Projekt HafenCity? Wütend ist nicht der richtige Ausdruck. Aber es bleibt eine Wunde. Ich habe bereits 2003/2004 prüfen lassen, unter welchen Bedingungen wir diese Straßendimensionen zurücknehmen können und da hat sich gezeigt, dass wir im Bereich der HafenCity nicht auf vierspurige Straßen werden verzichten können bei Prognosen von bis zu 50.000 Fahrzeugen in einigen Bereichen. Ich halte das aber nicht für ein strukturelles Thema der HafenCity, weil wir die Parkplätze im Wesentlichen unterirdisch verbannt haben und man Flächen in den Straßen zurückbauen kann, wenn das politisch gewollt ist. Ich glaube, dass die HafenCity den Individualverkehr betreffend sehr viele Anpassungsmöglichkeiten in der Zukunft hat. Die kann man nutzen, das ist durch die Struktur der HafenCity nicht verbaut. Das ist mir ganz wichtig.
In den vergangenen zwei Jahren haben Sie sich einen grünen Rucksack aufgeschnallt: Weniger Verkehr und Lärm, mehr Lebensqualität und nachhaltige Mobilität. Wodurch sind Sie vom Backstein-Bau-Saulus zum grünen Stadtplanungs-Paulus geworden? Eine nachhaltige Stadtstruktur hat mich von vornherein bewegt. Wir haben seit 2007 ein Zertifizierungssystem für die Gebäude auf den Weg gebracht und weiterentwickelt, wir waren 2007 Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Es gab also immer eine strategische Ausrichtung auf eine Verbesserung der Nachhaltigkeit. Das gilt auch für die soziale Integration und soziale Resilienz, die ja im übertragenen Sinne auch ein grüner nachhaltiger Rucksack sind. Es war mir immer ein wichtiges Anliegen, für die Bedürfnisse der Bewohner Möglichkeiten der Weiterentwicklung zu schaffen. Damit das offensichtlicher wurde, musste zunächst einmal eine U-Bahn gebaut werden, die eine größere Vernetzung und die Nutzungsmischung darstellte. Ohne die kann man keine grüne Stadt bauen.
Nachhaltigkeit ist seit Jahren in den Großstädten das Thema, aber erst jetzt kommen Projekte wie EdgeElbside (nachhaltiges Bürogebäude), Roots (Deutschlands höchstes Holzhaus als CO2-Speicher) oder Moringa (als voll wiederverwertbarer Bau nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip) als Einzelprojekte in „der Stadt der Zukunft“, wie Bürgermeister Peter Tschentscher die HafenCity nennt, an. Warum so spät und warum nur Einzelprojekte? Woraus, denken Sie, entstehen ganze Stadtteile? Sie entstehen vor dem Hintergrund konkreter verfügbarer Lösungsmöglichkeiten. Es dauert auch eine gewisse Zeit, innovative Projekte anzustoßen. Roots, für das jetzt der Grundstein gelegt wurde, haben wir Weihnachten 2016 erstmals besprochen. Wir haben aber auch deswegen so wenige Projekte, weil es für viele Fragen noch keine überzeugenden Lösungsmöglichkeiten gab und gibt. Solche Gebäude sind erheblich teurer, sie müssen also finanziert und es müssen Kunden gefunden werden, die für diesen Mehrwert zahlen. Wir müssen aber auch eine Vielzahl von Projektentwicklern finden, die über den HafenCity-Platin-Nachhaltigkeitsstandard hinaus die Fähigkeit entwickeln wollen, aufwändig neue Projekte zu planen. Moringa etwa gab es bei Landmarken nirgendwo aus dem Regal zu ziehen, sondern musste gemeinsam vor dem Prozess der Anhandgabe des Grundstücks entwickelt werden. Das gilt für all diese Projekte.
Das klingt wenig optimistisch für eine grünes Bauen in Serie? Vielleicht werden wir beim Grasbrook in der Lage sein, einen durchgehend höheren Standard zu haben. Aber auch unser Null-Emissionshaus, das ich noch auf den Weg gebracht habe, wurde bis auf eine Ausnahme in Deutschland, noch nirgendwo umgesetzt. Die Architekten sind unsicher, was sie erfüllen müssen, es fehlt an Wissen der Fachingenieure. Dafür müssen wir einen Wissenspool zur Verfügung stellen und einen Pool von Investoren und Bauherren heranziehen, die den Mut aufbringen, so etwas Neuartiges auch vor dem Hintergrund ökonomischer Rahmenbedingungen umzusetzen.
Sie haben sicher Ihren Einfluss für Ihren Nachfolger Dr. Andreas Kleinau geltend gemacht. Was hat er, was Sie nicht haben? Er hat einen ganz anderen Hintergrund und viele große Immobilienprojekte in der Beratung konzipiert. Damit ist eine wichtige Voraussetzung geschaffen worden, um die Arbeit der Gesellschaft weiter zu führen. Was er sicherlich nicht hatte, war das Stadtentwicklungswissen, das Wissen über Infrastrukturplanung und soziales Bauen von Stadt. Das war ein Defizit, das jetzt durch das vergangene Jahr, seitdem er bei uns ist, verschwunden ist. Mein Nachteil liegt im Nicht-Wissen über die Potenziale der Digitalisierung. Herr Dr. Kleinau ist beinahe 20 Jahre jünger und kennt sich mit der Nutzung der digitalen Tools viel besser aus. Und er hat dank seiner Erfahrung in der Organisationsberatung die HafenCity GmbH schon organisatorisch auf eine breitere Personalstruktur gestellt und damit die Gesellschaft in eine andere Möglichkeitsebene hineingeführt, die unerlässlich ist für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.
Sind neue Qualitäten erst im „Machen“, im Job zu optimieren? Ja. Wenn man eine solche Aufgabe übernimmt, hat man immer Erfahrungs- und Wissenslücken und man muss willens sein, diese auszufüllen und daran zu arbeiten. Stadt ist ein hochkomplexes Produkt, einige sagen, die bedeutendste Erfindung der Menschheit. Ich fand das immer interessant, weil es mir immer neue Perspektiven eröffnet hat.
Jetzt machen Sie einen Schnitt und gehen in den sogenannten Unruhestand. Müssen Sie sich erholen? Es wird keine bewusste Phase des Erholen-Wollens, sondern eher des Möglichkeiten-Aufschließens geben. Ich hoffe, in der besseren Nach-Pandemie-Situation kann ich ins Theater oder in Konzerte gehen. Mir fiel erst kürzlich auf, wie lange ich nicht im Theater war. Bestimmte Möglichkeiten der Teilnahme am kulturellen Leben haben sich in den letzten Jahren mit der Neukonzeption von Stadtentwicklung vor allem neben der HafenCity nicht mehr eingestellt. Das ist schon eine Verarmung des bürgerlichen Lebens gewesen, dass man entweder Stadtentwicklungsthemen bewegt oder gelesen oder sein Fitness-Programm erfüllt hat. Einige Dinge fallen mir sehr leicht, zum Beispiel verzichte ich schon seit Jahren aufs Fernsehgucken und habe mir so Freiräume erarbeitet, die ich zukünftig anders nutzen kann.
Werden Sie die HafenCity erst einmal nicht besuchen? Nein. Ich glaube, ich brauche keine Distanz, aber werde auch die Entwicklung nicht kommentieren. Ich bin sehr interessiert am Fortgang der Projekte und werde weiterhin im Fitnessstudio sein und mir kein neues Studio suchen, nur weil ich nicht mehr in der HafenCity arbeite. Infolgedessen begleiten mich nur positive Erinnerungen an die HafenCity, so dass ich mir einige neue Lieblingsorte suchen kann.
Welchen Traum möchten Sie sich erfüllen? Ich möchte, dass aus meinen Erfahrungen in der Stadtentwicklung eine Sammlung interessanter Aufsätze und Themen entsteht, die ich weitergeben kann an Studierende, an Fach- und Berufskollegen, national und international. Dabei geht es mir nicht um ein Nacherzählen der HafenCity, sondern um das verallgemeinerte Lehren aus Stadtentwicklung am Modell HafenCity.
Bei Ihrer Expertise müssen Sie uns einen Rat geben: Wie bekommen wir die Klimakrise in den Griff? Das ist nicht einfach zu beantworten. Für den Grasbrook denken wir gerade darüber nach. Wir können beinahe emissionsneutrale Gebäude bauen, aber nur beinahe. Untergeschosse werden immer noch mit Stahl und Beton gebaut. Wir können aber unterirdisch nicht mit Holz bauen. Das heißt, wir haben noch gar nicht die Voraussetzungen, emissionsfrei zu bauen, weil das voraussetzt, dass Stahl und Beton emissionsfrei hergestellt werden könnten. Es gibt viele Wenn-Fragen und das begleitet uns die nächsten 20 Jahre. Wir sind im Augenblick nicht in der Lage, alle Prozesse des Stadtbauens emissionsfrei darzustellen und Produkte emissionsfrei herzustellen, die wir bräuchten, um klimaneutrale Stadtquartiere zu entwickeln. Das bedeutet kontinuierliche Anstrengungen.
Welche Weisheit geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg? Hartnäckig sein und kreative Lösungen finden.
Was wird Ihre letzte Tat in der Osakaallee 11, dem HafenCity-Sitz, am 31. Oktober 2021 sein? Ich glaube, ich werde meinen Dienstwagen und meinen Laptop abgeben.
Was empfehlen Sie den Anwohner:innen und Gewerbetreibenden in der HafenCity für die kommenden Jahre? Zeigen Sie Engagement für sich und die Mitbewohner, Ihre Nachbarn und bringen Sie sich ein. Zeigen Sie, auch wenn es manchmal nicht einfach ist, den Optimismus und die Überzeugung, die notwendig ist, um Stadtzukunft zu gestalten. Die HafenCity ist nie fertig.
Das Gespräch führte Wolfgang Timpe