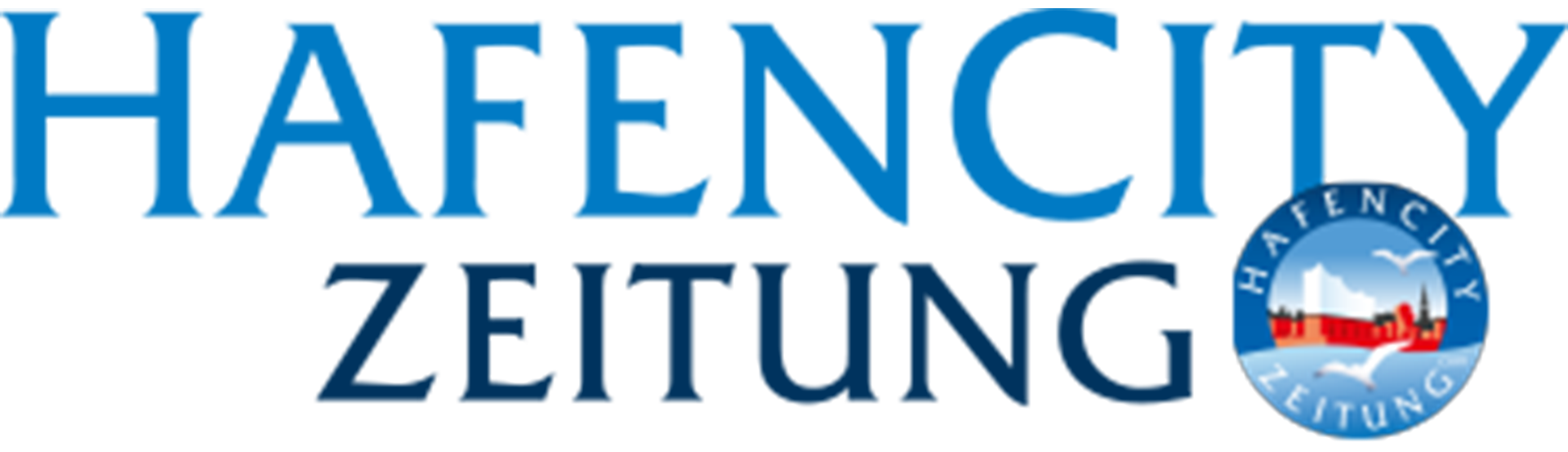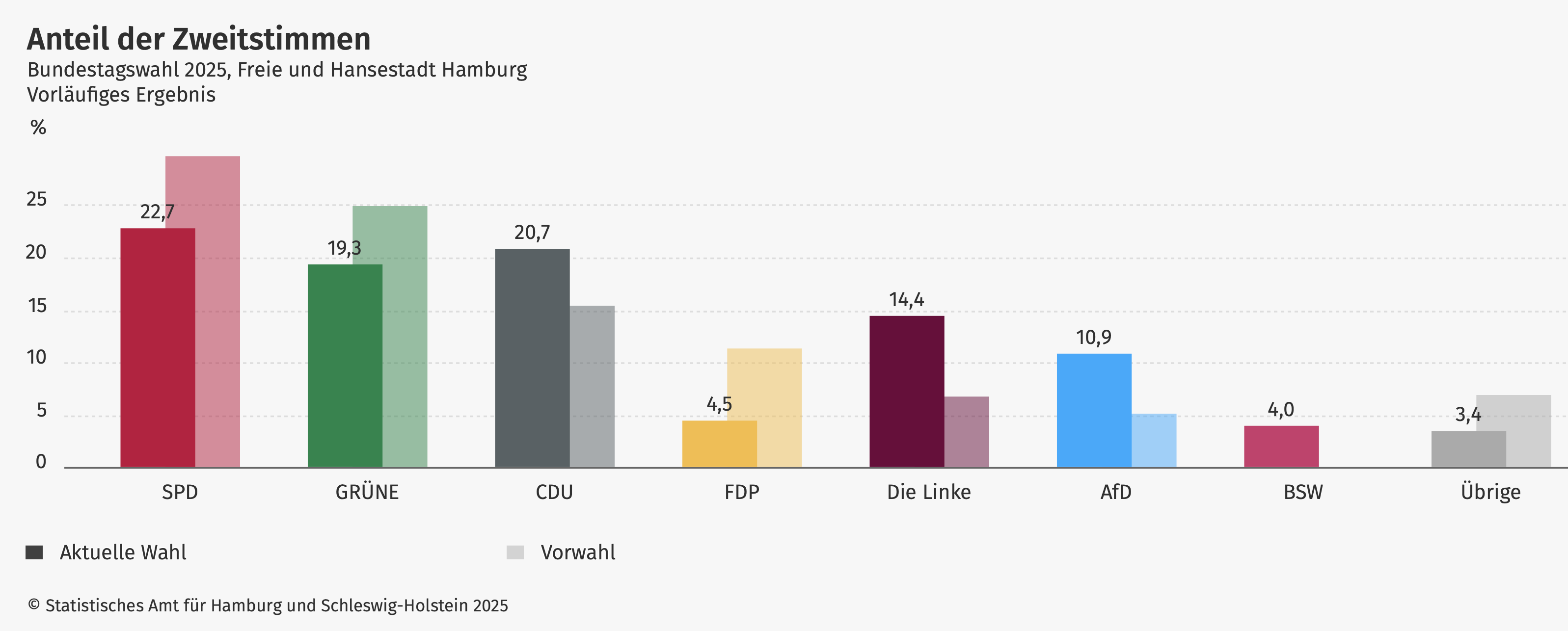Exklusiv-Gespräch. Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration, über Pandemiefolgen, Flüchtlinge und: Schokolade
Frau Leonhard, Sie sind eine Multi-Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration. Wie wird man eine so machtvolle Amtschefin? Die Behörde ist in den letzten Jahren gewachsen, und das hat vor allem damit zu tun, dass die Themen miteinander zusammenhängen und deswegen auch am besten in einem Hause bearbeitet werden können. Insofern würde ich sagen, dass meine Aufgabe vor allen Dingen vielseitig ist.
Foto oben: Senatorin Melanie Leonhard: „Was Frauen historisch besser gelernt haben, ist, Situationen nicht zu beklagen, sondern sie anzunehmen und was daraus zu machen. Und wenn ein Mensch diese Eigenschaft hat, kann er oder sie unverdrossen in die Zukunft schauen.“ © Catrin-Anja Eichinger
Aber Sie haben Einfluss mit den vielen Behörden und Ressorts. Sind Sie die heimliche Bürgermeisterin? Nein, nein, das bin ich nicht. Es gibt ja immer diese Debatte: Was ist in der Politik das wichtigste Feld? Meine Erfahrung ist hingegen: Es gibt nicht das eine wichtigste Feld. Wenn irgendwo etwas kolossal nicht funktioniert, betrifft das alle. Und deswegen haben alle immer ein Interesse daran, dass die Aufgaben für die Stadt in allen Politikfeldern gut erledigt werden und es überall einigermaßen gut läuft.

Aus der Corona-Pandemie wird nun offenbar eine Endemie. Ist Corona nur noch eine Grippe-Variante? Nein, das kann man so weiterhin nicht sagen. Das sehen auch viele Infektionsmediziner so. Aber wir haben jetzt das geschafft, was wir uns am Anfang gewünscht haben: Wir haben einen Weg gefunden, wie man gut mit dem Coronavirus umgehen kann, und wir wissen, was im Fall einer Infektion zu tun ist. Insofern ist die Aufmerksamkeit, mit der wir uns dieser Krankheit widmen, nun berechtigterweise eine ganz andere. Aber es war ein Thema, das uns zweieinhalb Jahre sehr beschäftigt hat.
Die Corona-Maßnahmen bieten nach wie vor einen Flickenteppich. Schleswig-Holstein und drei andere Bundesländer verzichten auf alle Regelungen. Sie und der Senat halten an Maskenpflicht im ÖPNV und Quarantäneregelungen bei Covid-Erkrankung fest. Warum? Es gab die Vereinbarung, eine bundesweit einheitliche Lösung umzusetzen – bis sich vier Bundesländer entschieden haben, einen eigenen Weg zu gehen. Viele haben dafür geworben, bei einer gemeinsamen Linie zu bleiben. Dass ein Land wie Schleswig-Holstein sich anders entschieden hat, ist natürlich blöd – vor allem für die Pendler.
Dr. Melanie Leonhard ist Präses der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration, kurz: Sozialbehörde, und seit März 2018 Landesvorsitzende der SPD Hamburg. Die 45-jährige promovierte Sozial- und Wirtschaftshistorikerin hat Hamburg seit Sommer 2020, als sie zusätzlich zu den anderen Ressorts auch Präses der Behörde für Gesundheit wurde, erfolgreich durch die Pandemie geführt. Aktuell steht unter anderem ihre Aufgabe als Integrationssenatorin im Vordergrund, da die wachsenden Flüchtlingszahlen mit circa 80 bis 100 Personen pro Tag – vor allem aus der Ukraine – zunehmen und viele neue Unterkünfte organisiert werden müssen. So entsteht für die HafenCity und Rothenburgsort eine Aufnahmestation auf dem Huckepackbahnhof-Gelände für 500 Schutzsuchende.
Nach dem Abitur 1996 am Lessing-Gymnasium in Hamburg machte Leonhard ein freiwilliges soziales Jahr, studierte Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und schloss es 2009 mit ihrer Promotion ab. Politisch ging sie in der SPD den Kärrnerweg über Bezirksversammlung Harburg, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, Fraktionsleitung, seit Oktober 2015 führt sie die Behörden für Arbeit, Soziales, Familie und Integration. Melanie Leonhard ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt in Hamburg-Sinstorf, Harburg.
Warum finden die Minister:innen und Senator:innen in den Ländern keinen gemeinsamen Weg? Medizin ist doch eine Wissenschaft mit Erkenntnissen und Regeln. Warum nicht auch für die Politik? Wir haben uns gemeinsam verständigt. Das, was wir gemeinsam mit zwölf Bundesländern umsetzen, ist also keine Sonderrolle, sondern die Mehrheitsrolle. Wir wissen uns dabei im Einvernehmen mit den bundesweiten Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und vor allen Dingen mit der Erfahrung, dass ein Winter lang ist und wir in den letzten Jahren schon häufiger erlebt haben, dass Menschen Regeln abgeschafft haben, die dann doch wieder eingeführt werden mussten.
In der Pandemie waren Sie vor allem als Gesundheitssenatorin gefordert. Was hat Sie in der Zeit besonders belastet? Eindämmungsmaßnahmen wie geschlossene Geschäfte oder Kontaktbeschränkungen waren notwendig und effektiv. Mich hat aber sehr belastet zu sehen, was das mit den Menschen gemacht hat, die davon betroffen waren. Das ging ja weit über den gesundheitlichen Bereich hinaus. Beispielsweise dadurch, dass auch Bildungseinrichtungen geschlossen waren. Das war alles nicht förderlich für das gesellschaftliche Zusammenleben. Das fand auch ich belastend.

Das heißt, wir alle haben in der Pandemie psychosozial verloren? Nein, das würde ich so nicht sagen. Eine Reihe von Menschen haben Corona genutzt, um sich neu und anders zu orientieren und Dinge zu beenden, wozu sie vorher nicht die Kraft hatten. Aber für viele war es trotzdem eine Belastung. Es gab und gibt beide Seiten der Medaille.
Was ist für Sie die größte Veränderung, die Corona mit sich gebracht hat? Dass wir alle jetzt eine Vorstellung von einer Pandemie haben, denn das war historisch-gesellschaftlich verloren gegangen. Zu wissen, was im Falle einer Pandemie über eine Gesellschaft kommt, ist etwas, das bleiben wird. Das ist, glaube ich, die tiefgreifende Veränderung. Hinzu kommen ganz praktische Veränderungen, die wir vorher für undenkbar gehalten haben, wie zum Beispiel Geschäftsreisen, die zum Teil nicht mehr im gleichen Maß zurückkommen, weil man auf andere, digitale Weise kommuniziert. Das hätte man sich vor drei Jahren nicht zugetraut. Jetzt wird es nebenbei erledigt. Dadurch gewinnen wir Lebensqualität zurück.
»Beruflich fehlte es an Begegnung, an Zeit und Raum für bestimmte Dinge und Planungen. Das war schon sehr fordernd. Privat sind Momente der Unbeschwertheit zu kurz gekommen. Völlig freie Tage gab es nicht.«
Melanie Leonhard über die Folgen der Pandemie
Während der Pandemie waren die Menschen freundlicher, verständnisvoller und zugewandter. Jetzt, so scheint, ist die kapitalistische Realität stärker denn je zurück. Nehmen Sie das auch so wahr? Ja, es gibt solche Situationen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Menschen glauben, etwas aufholen zu müssen, und dann verlieren sie schnell die Geduld. Wer ein, zwei Jahre nicht im Kino war, will nicht wegen einer Eintrittskarte in der Schlange stehen, sondern sofort drankommen. Wir haben plötzlich eine Erwartungshaltung, dass alles genau wieder so kommt, wie wir denken, dass es einmal war. Dabei hat auch schon vor der Pandemie nicht alles reibungslos geklappt. Wir überfordern Systeme, die jetzt erst wieder an den Start gehen können, mit unserem Anspruchsdenken. Da, finde ich, sollten wir miteinander langmütiger sein.
Hat die gesellschaftliche Nervosität zugenommen? Wir leben einfach in einer Situation, die wir als Hamburger:innen, als Deutsche über viele Jahrzehnte nicht kannten. Die Welt ist in Aufruhr, in unserer Nachbarschaft herrscht Krieg und Krise. Das ist für alle eine Belastung, auch wenn wir nicht direkt betroffen sein mögen. Auf uns wirken Leute dann angespannt, nervös, schlecht gelaunt. In Wahrheit sind sie erst einmal belastet.
Stichwort Krieg in der Ukraine: Ängstigt es Sie, dass unweit von Berlin Raketen einschlagen? Ja, natürlich, es berührt mich und beeinträchtigt unseren Alltag. Gleichwohl ist es eine gute Gelegenheit, eine Positionsbestimmung vorzunehmen und sich zu fragen: „Was haben wir erreicht?“ Wir haben trotz solcher Krisen einen handlungsfähigen Staat. Wir haben eine Sozialpolitik, die unsere Gesellschaft so absichert, wie es sich andere Länder nur wünschen können. Wir haben kreative Menschen, die sich immer wieder was Neues ausdenken. Und wir leben in einer Demokratie zusammen. Sich das vor Augen zu führen zeigt, wie gut es uns geht.
Wer war in dieser schweren Zeit Ihre größte Stütze, Ihr Mann oder der Labormediziner und Erste Bürgermeister Peter Tschentscher? Ich käme nicht auf die Idee, diesen Vergleich anzustellen. Beide sind in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich wichtige Menschen. Aber natürlich kann man beruflich besser wirken und mehr leisten, wenn zu Hause alles stimmt. Und dieses große Privileg habe ich.
Was ist in diesen Krisenmonaten zu kurz gekommen – beruflich als Multi-Senatorin und privat? Beruflich zeichnen sich Krisen – und das gilt für Corona in besonderem Maße – dadurch aus, dass man ad hoc die Dinge bewältigt, die auf einen zukommen. Und dadurch kam in so manchen Bereichen anderes zu kurz. Es fehlte an Begegnung, an Zeit und Raum für bestimmte Dinge und Planungen. Das war schon sehr fordernd. Privat sind Momente der Unbeschwertheit zu kurz gekommen. Völlig freie Tage gab es nicht. Ein verlängertes Wochenende mit der Familie zum Beispiel habe ich mir nicht erlaubt, weil ich auch am Samstag und Sonntag in die Behörde musste. Es war nicht möglich, nicht daran zu denken, was passieren wird, wenn irgendetwas schiefgeht. Aber das ist vielen Menschen so ergangen: Die Momente der Unbekümmertheit, der Unbeschwertheit und der Lässigkeit, auch mal Dinge einen Tag liegen lassen können, haben gefehlt.
Im Nachhinein sind ja alle Mediziner:innen und Ärzt:innen schlauer als die Politiker, die Entscheidungen treffen mussten. Hand aufs Herz nach zweieinhalb Jahren: Welche Entscheidung, die Sie getroffen haben, war aus heutiger Sicht falsch oder weniger glücklich?
Oh, da gab es eine Menge, weil wir immer wieder vom Virus gelernt haben, dass die Dinge doch anders sind. Wenn wir im März 2020 gewusst hätten, wie es mit Corona weitergeht, hätten wir zum Beispiel niemals Kita-Schließungen angeordnet. Das war falsch – aber das haben wir eben auch nicht gewusst.
Sind die Menschen eher nachtragend oder versöhnlich? Es gibt überall im Leben solche und solche. Ich erlebe viel Zuspruch und dass Menschen sagen, „in Ihrer Haut möchte ich nicht stecken“. Und es gibt diejenigen, die sagen: „Wie kann man nur so doof sein?“ Ich erlebe beides, und deswegen ist das auszuhalten.
Hat sich durch die Pandemie unsere Gesellschaft, haben wir uns verändert? Erlebt zu haben, dass es Situationen geben kann, in denen Kontakt und gesellschaftliches Miteinander beschränkt sind, macht etwas mit der Persönlichkeit. Das wird bleiben.
Als Integrationssenatorin sind Sie auch für Flüchtlinge, die bei uns Schutz suchen, zuständig. Die private Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nimmt in Hamburg deutlich ab. Schaffen wir, schaffen Sie und der Senat das? Wir müssen das schaffen, weil wir den Menschen aus der -Ukraine helfen müssen. Gleichwohl ist es eine riesige Aufgabe und bedeutet, dass wir jede Woche eine größere Unterkunft eröffnen müssen. Das ist einerseits eine große Herausforderung in einem Stadtstaat mit seiner begrenzten Immobilienlage und andererseits aber auch personell. Es müssen schließlich auch Menschen vor Ort sein, die sich kümmern, die ansprechbar sind.
Der Senat hat beschlossen, dass in jedem Stadtteil Flüchtlingsunterkünfte gebraucht werden. In Rothenburgsort entsteht gerade eine für 500 Menschen, in der HafenCity keine. Warum?
Die große Flüchtlingsunterkunft, die wir gerade auf einem Gelände der HafenCity GmbH für über 500 Menschen am Standort des sogenannten Huckepackbahnhofs im Billebogen errichten, ist für Rothenburgsort und die HafenCity.
Das ist nicht die eigentliche HafenCity. Sondern ganz am östlichsten Rand, ja. Wie gesagt, man braucht eben auch Platz für temporäre Einrichtungen. Wir sind für jegliche Immobilien-Vorschläge – auch aus der HafenCity – dankbar. Wir brauchen jeden Quadratmeter, den Hamburg möglich macht, damit wir für Menschen ein Dach über dem Kopf schaffen können.
Warum nimmt die private Aufnahme von Flüchtlingen in Hamburg ab? Weiterhin nehmen in ganz Hamburg viele Hundert Menschen Familien oder Einzelpersonen privat auf. Das ist eine große Leistung. Und wenn es dann in einzelnen Fällen manchmal nicht mehr weitergeht, sind die Gründe egal. Das ist völlig okay, wenn jemand sagt, unser Haus ist nicht dauerhaft geeignet für zwei Familien, wir brauchen auch unsere Privatsphäre zurück und wollen uns auch mal wieder um was anderes, das uns auch wichtig ist, kümmern.
Dann springt die Stadt ein? Ja, und das ist in Ordnung. Diese Aufgaben nehmen wir wahr. Die Menschen können sich bei uns melden, wir haben eine eigene Vermittlungsstelle dafür. Wir kümmern uns. Mir ist wichtig zu sagen, dass diese Menschen persönlich bis zu diesem Tag immer zur echten Lösung der Flüchtlingsunterbringung beigetragen haben. Und das ist was Gutes. Wir haben in Hamburg weiterhin eine wirklich große Gruppe von Menschen, die sich ehrenamtlich und freiwillig engagieren und uns dabei unterstützen. Das zeigt, dass das Thema in der Stadtgesellschaft angekommen ist, wenn es auch nicht an jedem Wohnzimmertisch, jeden Tag präsent ist. Und auch das ist okay.
Apropos HafenCity. Hat die Sozialsenatorin eine Meinung zu Hamburgs jüngstem Stadtteil und seinen Aufregerthemen Elbtower und Naturkundemuseum? Hat sie! (lacht) Ich finde, dass die HafenCity ein ganz besonderer Stadtteil ist, und seit einigen Jahren beginnt es dort auch langsam zu pulsieren. Das ist schön. Gleichwohl ist die HafenCity kein Dorf in Hamburg, sondern ein aktiver Teil der Stadt. Und deswegen wird dort auch weiter gebaut werden. Und da sind eben ein Elbtower und ein Naturkundemuseum ein Thema.
Und wie gefällt Ihnen persönlich der Elbtower? Ich finde, dass eine große Stadt wie Hamburg so etwas verträgt. Ob ich ihn am Ende schön finde oder nicht, entscheide ich, wenn es so weit ist. Ich persönlich würde auf meinem Weg in die Innenstadt jeden Tag daran vorbeifahren. Insofern glaube ich, dass das ein wichtiges Bauwerk der Stadt werden kann.
Beim Naturkundemuseum streitet man darüber, warum es in die HafenCity und nicht in die Innenstadt kommt. Braucht die Innenstadt mehr Hilfe? Ich glaube, dass die Standortfrage für das Naturkundemuseum nicht über das Schicksal der Innenstadt entscheidet.
Wie finden Sie architektonisch und stadtplanerisch die HafenCity? Ich kenne mehrere europäische Projekte, wo es um eine Umnutzung des Hafens ging. Und in dieser Riege muss sich die HafenCity nicht verstecken. Sie ist sehr gelungen. Und alles, was wir jetzt noch vermissen mögen, wird sich mit der Zeit einstellen. Es ist und bleibt ja ein sehr junger Stadtteil. Die Dinge, die einen Stadtteil bewohnt und herzlich machen, kommen noch.
Sie leben mit Ihrem Mann und Ihrem Sohn im Bezirk Harburg. Können Sie sich vorstellen, in die HafenCity zu ziehen? Nein, weil ich gerne in Harburg wohne, und ich werde mutmaßlich mein Leben auch weiterhin südlich der Elbe führen. Mir gefällt es da, ich mag die Menschen, es ist grün und gleichzeitig nah zur S-Bahn. Aber beides hat natürlich seinen Reiz, auch das urbane Leben in der HafenCity.
Sie sind Katholikin. Spielt das in Ihrem Alltagsleben eine Rolle? Nicht immer und zu jeder Zeit. Aber mein Glaube ist etwas, was mich als Persönlichkeit prägt und deswegen auch mein christliches Menschenbild und mein Handeln.
Gibt Ihnen der Glaube ein Wertegerüst? Für mich ist es eher eine Art inneres Geländer, wie ich es nenne. Man überlegt als Katholik ja nicht jeden Tag, ob man das weiterhin sein möchte.
Beten Sie? Nicht jeden Tag, aber es gehört für mich zum Leben dazu.
Worüber können Sie sich zurzeit freuen? Ich freue mich, dass es wieder Lebkuchenherzen und Spekulatius gibt. Das ist für mich im November immer das, was mir hilft, bis zur Adventszeit durchzuhalten.
Was macht Ihnen Angst? Die zunehmende Rigorosität in Debatten Angst. Es gibt manchmal kein Grau mehr, nur noch Schwarz und Weiß. Es wird mit großer Härte gegeneinander ausgefochten und mit jeder Form von Selbstgerechtigkeit. Diese Rigorosität in gesellschaftlichen und politischen Debatten hat sich seit zwei, drei Jahren enorm zuspitzt. Das besorgt mich.
Welche Herausforderungen sehen Sie für sich als berufstätige Mutter? Da geht es mir wie allen berufstätigen Eltern. Für uns ist es eine große Aufgabe, die Nerven zu behalten und die nötige Gelassenheit zu bewahren, wenn Dinge nicht funktionieren. Hinzunehmen, dass wir an einem Tag einfach nie 100 Prozent von dem schaffen, was wir uns vornehmen, sondern oft nur 70 Prozent. Bei allem, was man vor sich hat, ist das eine der größten Aufgaben. Und sich selber nicht zu vergessen ist noch eine weitere Herausforderung.
Sind Frauen die besseren Manager? Es gibt immer solche und solche. Was Frauen historisch besser gelernt haben, ist, Situationen nicht zu beklagen, sondern sie anzunehmen und was daraus zu machen. Und wenn ein Mensch diese Eigenschaft hat, kann er oder sie unverdrossen in die Zukunft schauen.
Sie sind nicht nur Multi-Senatorin, sondern auch Landes-SPD-Chefin. Haben Sie sonst nichts zu tun? (lacht) Doch, damit sind jedoch Aufgaben verbunden, die mir auch Freude machen. Es mag nicht jeder glauben, aber meine Partei, die Sozialdemokraten in Hamburg, macht mir Freude. Und ich profitiere von meinem Umgang und meinem Kontakt mit Genossinnen und Genossen in der Stadt. Das stärkt mich in meiner Arbeit. Insofern passt das im Moment noch gut zusammen.
Ist für Sie der Begriff Genossinnen und Genossen noch zeitgemäß? Das ist etwas, was meine Partei als Alleinstellungsmerkmal hat. Und es ist, wie es ist.
Führen Sie gerne? Es muss Ihnen ja doch irgendwie im Blut liegen, sonst hätten Sie nicht so viele Aufgaben. Ich glaube, ich habe eine Bereitschaft, Aufgaben anzunehmen und mich ihnen zu stellen. Ich tue das nicht jeden Tag gleich gerne, aber einigermaßen unverdrossen und mit gutem Gemüt. Das hilft mir.
Darf man Sie Pragmatikerin nennen? Durchaus. Ich bin es.
Warum ist das für Sie kein Schimpfwort? Na, weil Pragmatismus in vielen Situationen im Leben darüber entscheidet, ob man eine Situation oder einen Zustand annimmt, um ihn zu verändern, oder ob ich mich darauf beschränke, den Zustand zu beklagen. Ich gehöre zur ersten Gruppe. Man muss, um etwas zu verändern, anerkennen, dass es ist, wie es ist.
Steht die rote SPD im grünen Dauerfeuer der Mobilitätswende nicht im Senat wie ein Mauerblümchen da? Nein. Gute Senatsarbeit ist immer ein Zusammenspiel von allen. Mit Andreas Dressel ist es der SPD-Finanzsenator, der versucht, alles finanziell zu ermöglichen, was wir als Gesamtsenat tun. Wohnungsbau voranzutreiben, damit man bezahlbar leben kann, ist uns ein wichtiges Anliegen. Als Standort für Wirtschaft und Industrie relevant und attraktiv zu sein legt die Wurzeln des Wohlstands von Hamburg. Und auch die Sozial- und Gesundheitspolitik war nicht unbedeutend in den letzten Jahren.
Sie sind unter anderem Vorstandsvorsitzende der Stiftung Rickmer Rickmers, Vorstandsmitglied der Stiftung Lesen und im Heimatverein Harburg Stadt und Land. Warum engagieren Sie sich in Stiftungen? Ich engagiere mich vor allen Dingen inhaltlich, dass es Stiftungen sind, ist Zufall. Da ich studierte Historikerin bin, liegt mir zum Beispiel auch die Geschichte des Ortes, in dem ich lebe, am Herzen. Das erklärt mein Engagement im Heimatverein Harburg.
Wovon träumen Sie? Ich träume von einem Zusammenleben in einer Stadt, das von gegenseitigem Respekt und Zeit füreinander geprägt ist.
Was macht Sie glücklich? Schokolade macht mich glücklich. (lacht herzlich)
Wie schalten Sie ab? Hörspiele, Hörspiele, Hörspiele.
Was bedeutet Ihnen Weihnachten? Absolut viel. Es ist für mich auch wegen seiner Botschaft, dass wir eine positive Zukunft haben, eines der bedeutendsten Feste überhaupt. Dass man einen Grund hat, unverdrossen weiterzumachen und Kraft zu haben für die Dinge, die da kommen. Immer wieder neu anzufangen finde ich wichtig.
Wie feiern Sie Weihnachten? Mit meiner Familie.
Sie haben ohne Rücksicht auf Geld und Konventionen drei Wünsche für Hamburg frei. Welche sind das? Das kann ich nicht sagen, weil mir dann sofort jemand schreibt, welche drei Dinge ich nicht gesagt habe.
Was wollen Sie im Jahr 2023 anders machen? Beruflich nicht viel. Privat würde ich mich gern deutlich mehr bewegen.
Das Gespräch führte Wolfgang Timpe