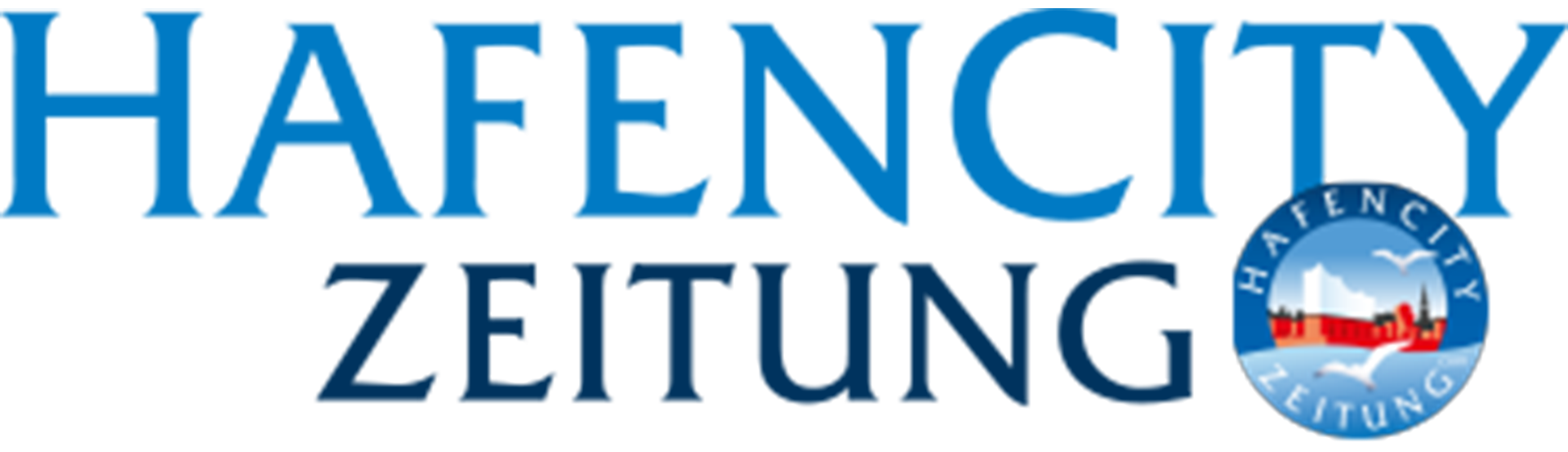Exklusiv-Gespräch. Senatorin Katharina Fegebank, Präses der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA), zieht nach sechs Monaten erste Bilanz über Zukunftsentscheid, Stadtbild-Debatte, Naturkundemuseum und Kühne-Oper
Der Klimawechsel in der Umweltbehörde ist live bei der Chefin zu spüren. Ihre sachliche, pragmatisch klare Tonlage wie auch ihre Ausstrahlung von Herzenswärme will und kann Katharina Fegebank nicht verstecken. Wir haben sie getroffen, um mit ihr eine erste Halbjahresbilanz nach dem Wechsel aus der Wissenschaftsbehörde zur BUKEA zu ziehen. Mit ihrer nachdrücklichen Energie und empathischen Durchsetzungskraft will sie den Anti-Habeck machen und nach den ganzen Ampeldramen Umweltschutz und Klimawandel wieder auf die Tagesordnung setzen.
Foto oben: Umweltsenatorin Katharina Fegebank vor dem jüngst eingeweihten Denkmal und Wahrzeichen der Wildtiere, vor der Deutschen Wildtier Stiftung im Baakenhafen in der HafenCity. © Catrin-Anja Eichinger
Frau Fegebank, Ihre Stimmung müsste eigentlich prächtig sein. Ihr Lieblingsfußballverein SV Werder Bremen hat Chancen auf einen Europacup-Platz, einen neuen bodenständigen Trainer Horst Steffen. Was erwarten Sie als Fan in dieser Saison und wer ist Ihr Lieblingskicker? Was für eine schöne Einstiegsfrage! Ich hoffe, dass Werder Bremen mindestens einen gesicherten oberen Mittelfeldplatz erreichen wird. Bei Werder ist der Star gerade die Mannschaft – das gefällt mir auch sehr gut.
Was hat Werder Bremen, was andere Fußballvereine nicht haben? Mir ist das in die Wiege gelegt worden. Schon von klein auf bin ich begeisterter Fußballfan und bei uns in der Familie zählt natürlich „ein Leben lang Grün-weiß“. Trotz meiner Rolle als Zweite Bürgermeisterin und viel Sympathie auch für die Hamburger Clubs bin ich in meinem Herzen Werder-Fan geblieben. Ich mag diesen bodenständigen Club, der mit relativ kleinen Ressourcen, ziemlich kreativ über viele Jahre einen tollen Fußball gespielt hat. Mich fasziniert, wie verwoben der Verein und die Stadt Bremen miteinander sind.
Einen Sieg feierte Ihre grüne Partei auch beim Hamburger Zukunftsentscheid durch Volksabstimmung, sodass Hamburg nun schon 2040, fünf Jahre früher als geplant, klimaneutral sein muss. Sie persönlich und als Zweite Bürgermeisterin waren skeptisch, empfinden das Ziel ehrenwert, aber wirtschaftlich Stadt, Menschen und Industrie überfordernd. Was machen Sie jetzt als Umwelt- und Klimasenatorin mit Ihrer „Dr. Jekyll & Mrs. Hyde“-Rolle? In der Beschreibung und Bewertung finde ich mich nicht wieder. Ich bin vor dem Entscheid klar in diese Diskussion gegangen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir schon einen sehr ambitionierten Kurs auch in unserem aktuellen Koalitionsvertrag festgelegt haben. Wir hatten als Senat in Hamburg bereits definiert, dass wir als Hafenhandels- und Industriestandort die Klimaneutralität möglichst bereits vor 2045 schaffen wollen. Jetzt haben uns die Menschen n Hamburg mit ihrem Ja zum Zukunftsentscheid eine klare Aufgabe gegeben. Das wird herausfordernd, aber wir gehen das jetzt ebenso beherzt wie umsichtig an.
»Ich verstehe die Sorgen. Der gesamte Senat ist in intensiven Gesprächen mit der Wirtschaft. Wir wollen die Energiewende zur Erreichung der Klimaziele schaffen, ohne dass uns für die Unternehmen wie die Privathaushalte die Preise davongaloppieren. Der Gamechanger kann unter anderem die Elektrifizierung sein.«
Katharina Fegebank
Sie gelten als wirtschaftsorientierte Pragmatikerin. Da mag man Festlegungen, ohne die Rahmenbedingungen genau zu kennen, nicht so sehr. Erst einmal finde ich gut, dass wir jetzt ein Ergebnis haben und nach vorne gucken. Es muss jetzt darum gehen, wie man es als Stadt mit allen Beteiligten schaffen kann. Das ist herausfordernd. Unabhängig davon habe ich mich darüber gefreut, dass das Klimathema, das die letzten Jahre ein wenig unter die Räder geraten ist und leider oft als Blockadebegriff benutzt wurde, wieder auf der Agenda steht. Das gilt für Hamburg, Deutschland und darüber hinaus: Wir müssen beim Klimathema in Europa wieder Motor und wettbewerbsfähiger im globalen Kontext werden.
Wie soll das gehen? Wir sind beim Erreichen der Klimaziele in Hamburg ehrgeizig, aber wir werden es nicht allein schaffen. Der Bund und die EU müssen mit Rahmenbedingungen und Gesetzgebungen Voraussetzungen für ein schnelleres Erreichen von Klimazielen schaffen. Die aktuelle Phantomdebatte, das Verbrenner-Aus 2035 zu verlängern, führt zum Beispiel nur zu Verunsicherung bei Unternehmen und Verbrauchern. Stattdessen sollten wir bei den Klimazielen auf das Pedal drücken.
Das hilft aktuell den Sorgen von Hamburger Handelskammer, Industrievertretern und Firmen des Mittelstands konkret nicht. Die sind einfach sauer über den Zukunftsentscheid und das Vorziehen der Klimaneutralität auf 2040. Ich verstehe die Sorgen. Der gesamte Senat ist in intensiven Gesprächen mit der Wirtschaft. Wir wollen die Energiewende zur Erreichung der Klimaziele schaffen, ohne dass uns für die Unternehmen wie die Privathaushalte die Preise davongaloppieren. Der Gamechanger kann unter anderem die Elektrifizierung sein, das konsequente Setzen auf ÖPNV, E-Mobilität und der flächendeckende Ausbau von E-Ladesäulen. Dafür muss aber auch der Bund seinen Teil tun, zum Beispiel bei den Netzentgelten. Da wollen wir Klarheit – gemeinsam mit der Industrie, den Unternehmen und den Kammern. Wir setzen auf Innovationen und technologischen Fortschritt, werden bei den erneuerbaren Energien, der Fernwärme und thermischer Abfallverbrennung in Hamburg weiter. Ich bin optimistisch: Wenn der Bund und Europa mitspielen, werden wir in der 30er Jahren deutliche Fortschritte bei der nachhaltigen Senkung der CO₂-Emmissionen machen.
Sind Volksabstimmungen, mit der Hamburger Olympia-Bewerbung steht ja die nächste an, noch zeitgemäß und politisch zielführend? Es gab außerhalb von klassischen Wahltagen noch nie eine so hohe Beteiligung der Hamburgerinnen und Hamburger wie beim Zukunftsentscheid. Am Ende hat die klare Mehrheit gesagt: „Wir wollen, dass Ihr euch noch mehr anstrengt.“ Für mich sind Volksabstimmungen ein wichtiges Element unserer
Demokratie.
Wie geht die Olympia-Entscheidung nächstes Jahr aus? Nach der jüngsten Studie des Glückatlas’ ist die große Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger besonders zufrieden mit der Lebenssituation in der Stadt. Trotz aller Kriege, Krisen und Konflikte, sind wir nach wie vor eine recht wohlhabende Stadt mit stabilen politischen Verhältnissen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns Olympia nicht nur zutrauen, sondern dass wir auch Begeisterung entwickeln und gemeinsam eine positive Bewegung für die Idee von Olympia in unserer Stadt starten können.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Stadtbild-Debatte angestoßen, und auch Ihr grüner Bundesvorsitzender Felix Banaszak diagnostiziert bei uns im Land „Angsträume“. Wie sehen Sie das Hamburger Stadtbild? Wenn ich auf Hamburg gucke, sehe ich eine in allen Stadtteilen eine bunte vielfältige Gesellschaft. Das Miteinander und die Vielfalt sind eine große Chance für unsere Stadt und ein großer Standortvorteil. Zugleich sehe auch ich Orte, die bei manchen Unbehagen und in Teilen auch Angst auslösen. Was mich an der Stadtbild-Debatte der vergangenen Wochen stört, dass sich da vermeintlich unversöhnliche Lager gegenüberstanden. Die Diskussion war überhaupt nicht nach vorne gerichtet. Da sehe ich auch beim Bundeskanzler eine Verantwortung, für das ganze Volk zu sprechen. Gleichzeitig muss man natürlich auch darüber sprechen, dass es in unseren Städten und auch in Hamburg, Orte gibt, an denen wir weiter politisch etwas bewegen müssen, weil sich die Menschen dort nicht wohlfühlen.
Zum Beispiel am Hamburger Hauptbahnhof. Geht der Senat und geht Ihre Partei die Grünen damit nicht offensiv genug um? Wir sprechen Probleme an und wir gehen sie an. Mich stört, dass Dinge zum Beispiel vom Bundeskanzler nicht klar angesprochen werden und so zu neuen Ressentiments führen. Er hat bis heute nicht gesagt, was genau er mit Stadtbild meint. Nur wenn man weiß, wovon man spricht, kann auch gemeinsam überlegen, welche ordnungspolitischen und vor allem sozialpolitische Maßnahmen sinnvoll sind. Das ändert nichts daran, dass wir solche Debatten klar führen dürfen.
Vita: KATHARINA FEGEBANK
ist seit 15. April 2015 Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg – in einem rot-grünen Senat zunächst unter Olaf Scholz und nun nach über zehn Jahren auch im sogenannten Tschentscher-III-Senat mit dem Ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher. Seit 7. Mai 2025 und der Neuaufstellung des Senats Tschentscher III leitet sie neu als Präses die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA). Die 48-Jährige war Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen zur Bürgerschaftswahl am 2. März 2025 und direkte Herausforderin des Ersten Bürgermeisters Dr. Peter Tschentscher (SPD).
Katharina Fegebank, Tochter eines Lehrerehepaares, aufgewachsen in Bargteheide, Kreis Stormarn, schloss 2002 ihr Studium der Politikwissenschaft, Anglistik und des Öffentlichen Rechts an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg als Magister Artium (MA) und mit einem Master of European Studies (M.E.S.) der FU, HU und TU Berlin ab. Bis zur Ernennung als Senatorin, u. a. von 2020 bis 2025 als Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke, war sie von 2008 bis 2015 unter anderem jüngste Parteichefin der Grünen in Hamburg.
Katharina Fegebank lebt mit dem Unternehmer Mathias Wolff und den beiden Zwillingstöchtern (sieben Jahre) im Grindelviertel in Hamburg-Eimsbüttel.
Der Senat will das neue Naturkundemuseum, das „Evolutioneum“ im Elbtower, realisieren. Für Sie soll es eine internationale Strahlkraft für die Erforschung zur Artenvielfalt und Biodiversität entwickeln. Was hat Hamburg davon? Neben der Klimakrise ist das Artensterben die größte Krise unseres Planeten. Sie ist eine verborgene Dramatik, weil sie nicht jeden Tag wahrgenommen wird. Hamburg ist nicht nur im Bereich Klimaforschung, sondern auch im Bereich der Biodiversitätsforschung ein exzellenter Standort. Unser Naturkundemuseum hat eine einzigartige Sammlung, die mit dem Evolutioneum wieder seine volle Blüte entwickeln kann. Im Elbtower wird, wenn die Prüfungen positiv abgeschlossen werden, ein Museum entstehen, das als Forschungsstandort und Ausstellungsmuseum für die Hamburgerinnen und Hamburger wie auch für ein internationales Publikum und Touristen aus aller Welt die aufsehenerregende Eintrittskarte in die Stadt werden.
Und was antworten Sie den Spöttern, die infrage stellen, dass man ein millionenteures Museum zur „Artenvielfalt von Bienen“ errichtet, wo es doch so viel anderes Wichtiges zu finanzieren gäbe? Diesen Stimmen begegne ich auch und lade alle schon mal ein, sich das heutige, zugegebenermaßen kleine und auch etwas unscheinbarere Naturkundemuseum anzusehen und sich eine erste Inspiration zu holen, was sich hinter den zehn Millionen Objekten verbirgt, die allein nur die Sammlung in Hamburg hat. Wer sich das anschaut, begreift, dass wir Menschen nichts sind ohne Biodiversität! Und deren Wandel muss dokumentiert und erforscht werden. Die Vielfalt der Arten in unserer Region, in Deutschland und auf dem gesamten Planeten ist für kommende Generationen enorm wichtig.
Die gedeckelten 595 Millionen Euro Kaufpreis für die rund 45.000 Quadratmeter im Elbtower für Archiv, Büro- und Forschungsplätze sowie Labore und Ausstellungsfläche sind mit rund 13.000 Euro pro Quadratmeter ein sportlicher Luxuspreis – deutlich über den Marktpreisen. Was rechtfertigt das? Ist das nicht doch Steuergeld für das Vollenden des Elbtowers des Privatkonsortiums um den Hamburger Investor Dieter Becken? Nein, es hat diverse Standortüberprüfungen von Bestandsgebäuden wie auch von Grundstücken für einen Neubau des Naturkundemuseums zum Beispiel in der HafenCity gegeben. Der auf der Grundlage geplante Neubau würde deutlich teurer kommen als der jetzt geplante Erwerb von Teileigentum im Elbtower. Es geht um Wirtschaftlichkeit und mit dem Prüfprozess ist die Stadt auf der Zielgeraden. Klar ist, dass das Evolutioneum nur in den Elbtower kommt, wenn die Bürgerschaft das mehrheitlich beschließt. Deshalb wird das gegenüber allen Fraktionen in der Bürgerschaft selbstverständlich gut begründet werden.
»Ich würde mir wünschen, dass wir uns Olympia nicht nur zutrauen, sondern dass wir auch Begeisterung entwickeln und gemeinsam eine positive Bewegung für die Idee von Olympia in unserer Stadt starten können.«
Katharina Fegebank
Der Büro-Quadratmeterpreis von rund 13.000 Euro bleibt sehr sportlich. Einspruch. Das Evolutioneum wird kein einfacher klassischer Bürobau. Die Anforderungen des neuen Naturkundemuseums an den Ausstellungsbereich und vor allem auch im Sammlungs- und Forschungsbereich. Bestimmte Räume haben deshalb besondere Anforderungen, müssen beispielsweise besonders erschütterungsarm sein. Der Preis steht sachlich im Verhältnis zu den Anforderungen des Museums und ist deutlich günstiger als alle bisherigen Kalkulationen für andere Standorte.
Sie sind jetzt über sechs Monate neue Umweltsenatorin. Wie fällt Ihre erste Bilanz aus? Ich wurde in der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft warmherzig willkommen geheißen – das hat mir den Start leicht gemacht. So wie ich als Senatorin Hamburg bei Wissenschaft und Forschung wieder auf die Exzellenzkarte packen konnte, habe ich im neuen Amt den Anspruch, Klimaschutz wieder nach oben auf die Agenda zu setzen – und zwar mit Freude und Lust Dinge zu gestalten und im Team miteinander Dinge zu bewegen.

Die Grünen haben zuletzt wieder ihr Nörgel- und Anti-Spaß-Image gepflegt. Wie wollen Sie das ändern? Ich denke, mir gelingt das gut, da ich mit beiden Beinen auf dem Boden stehe und die Dinge nicht von oben herab, sondern pragmatisch und mit einem herzlichen Angang gestalte. So kann man kreative Lösungen finden. Die Grünen sollten sich wieder stärker zu eigen machen, ihre Themen mit Energie und Lust einzubringen, den Bewegungsgedanken in der Politik wieder zu beleben und möglichst viele Menschen dazu zu bringen, guten Zukunftsideen zu folgen. Wir brauchen dafür hier und da mehr Mut.
Ihre Behörde hat als Klimaschutzaktion das „Abpflastern“ versiegelter Flächen zum Regierungsprogramm erhoben, von Grau zu Grün. Es sind mehr als 1.900 Projekte hamburg-weit identifiziert, und nur knapp 20 wurden nach Prüfung gestrichen. Wann wird das Abpflastern umgesetzt? Abpflastern ist in Hamburg ja noch recht neu. Das erste Jahr des Abpflastern war ein echter Erfolg. Über 5.000 Quadratmeter waren zuvor grau und wasserundurchlässig und heizten sich im Sommer auf – nun sind sie entsiegelt. Das bedeutet einen echten Gewinn für Mikroklima, Biodiversität und Lebensqualität. Das tolle ist: Beim Abpflastern können alle mitmachen und unsere Stadt grüner machen. Die Umsetzung der Vorschläge von Privatpersonen, Unternehmen und Initiativen sowie Vereinen geschieht dann über unsere
Bezirke.
Das kann dauern. Warum werden unter grüner Verantwortung überhaupt Flächen neu versiegelt wie bei der ehemaligen Wasserstofftankstelle am Brooktor in der HafenCity? Es gibt im Einzelfall immer Zielkonflikte, beispielsweise mit nachhaltiger Mobilität oder auch dem Wohnungsbau. Im Grundsatz ist aber klar: Die Biodiversität soll in der Stadt, überall wo möglich, konsequent genutzt werden. Das ist auch für das angesprochene Thema Artenvielfalt essenziell.
Alle Beteiligten von Stadt, Bezirk, Anwohner:innen und Initiativen hatten über 30 Projekte für „Mehr Grün in der HafenCity“ identifiziert. Nachüber zwei Jahren ist trotz Bürgerschaftsbeschluss keine einzige Maßnahme umgesetzt. Die ehrenamtlich Engagierten haben einen richtig dicken Hals. Das verstehe ich total – solch ein Engagement für eine grünere Stadt sollte sich natürlich unbedingt auszahlen. Leider hängt es oftmals an Finanzierungsfragen. Die Umsetzung muss deutlich besser werden.
»Ich bin schon immer ein totaler Weihnachtsmensch gewesen. Egal, wo ich gerade gelebt habe auf der Welt, bin ich immer mindestens für ein paar Tage nach Deutschland zurückgekommen und habe Heiligabend bei meinen Eltern in Bargteheide verbracht.«
Katharina Fegebank
Apropos Grün: Wie finden Sie den geplanten Baakenhöft-Park mit integriertem Opernhausgeschenk von Klaus-Michael Kühne? Es ist einfach eine Win-win-Situation ist. Wir sind dadurch in der Lage, ein neues Opernhaus in wirklich exponierter Lage zu bekommen. Der gerade vorgestellte Siegerentwurf der Bjarke Ingels Group aus Kopenhagen hat ein Operngebäude mit großer Strahlkraft und das Baakenhöft als öffentlich nutzbaren grünen Stadtteilraum direkt an der Elbe vorgestellt. Ich bin mir sicher, dass sie internationale Anziehungskraft haben wird. Und die neue Oper soll nicht als Raumschiff landen, sondern Teil des Quartiers sein.
Die Meinung von dessen Anwohner:innen hat bislang nicht wirklich interessiert. Das wird in den kommenden zwei Jahren bis zur endgültigen Opernhaus-Bauentscheidung Anfang 2028 passieren – es braucht dafür natürlich auch eine Einbindung des Stadtteils und der Menschen vor Ort.
Sind Sie Opernfan? Nein, nicht mit allergrößter Leidenschaft. Mein Musikgeschmack geht querbeet, da bin ich breit aufgestellt und mag gerne Singer-Songwriter Rock, Heavy Metal und Reggae. Durch meine Zeit in England nach dem Abi habe ich ein großes Herz für Britpop.
Sie leben mit Ihren beiden Töchtern, sieben Jahre alt, und Ihrem Lebensgefährten im Grindelviertel von Eimsbüttel. Haben die Zwillinge Ihre Sicht auf die Politik verändert? Auf jeden Fall, jeden Tag, weil ich natürlich durch die beiden einen zusätzlichen Sinn darin sehe, Politik zu machen und Stadt zu gestalten. Und hoffentlich so, dass diese auch nachhaltig demokratisch für die Kinder ist, die jetzt in diese Welt hineinwachsen. Dass jetzt vieles von dem, was ich tue, inzwischen auch damit zusammenhängt, dass ich allen Kindern und auch meinen eine gute Stadt und ein gutes Land hinterlassen möchte, motiviert mich noch zusätzlich.
Die Weihnachtsmärkte sind eröffnet, der 1. Advent steht vor der Tür, und Weihnachten kommt sicher. Wie feiert eine grüne Bürgermeisterin das große Fest? Ich bin schon immer ein totaler Weihnachtsmensch gewesen. Egal, wo ich gerade gelebt habe auf der Welt, bin ich immer mindestens für ein paar Tage nach Deutschland zurückgekommen und habe Heiligabend bei meinen Eltern in Bargteheide verbracht. Da kommen wir alle zusammen mit Gänsebraten, Klößen und Rotkohl sowie Bescherung und vorher in die Kirche gehen. Das ist auch schon bei meinen Kindern Teil der weihnachtlichen Erwartungshaltung.
Das Gespräch führte Wolfgang Timpe