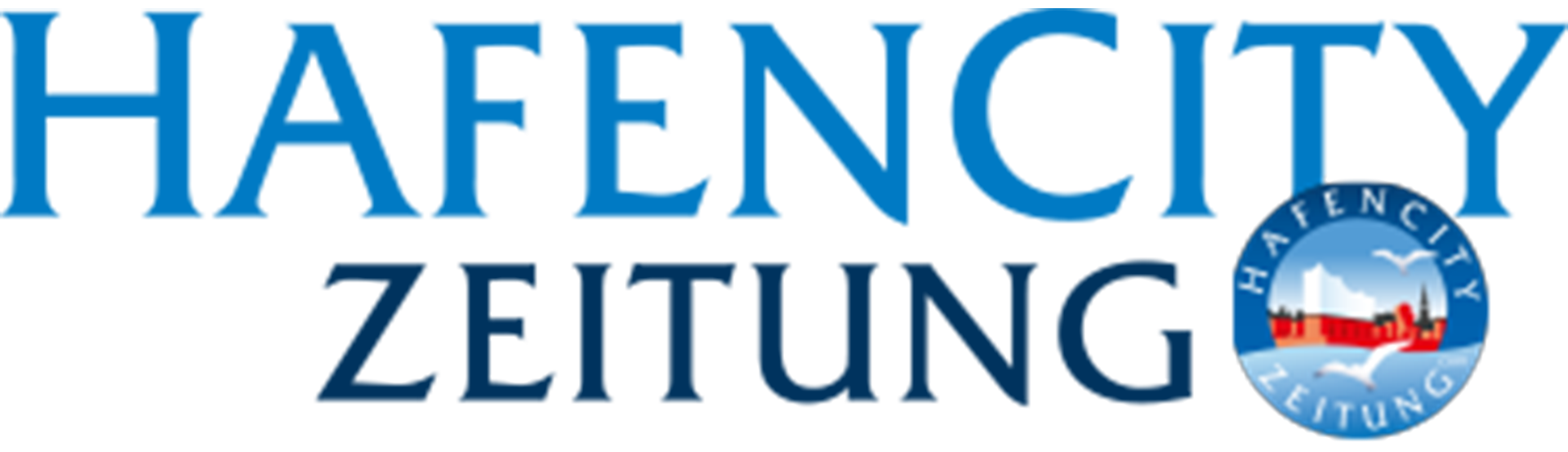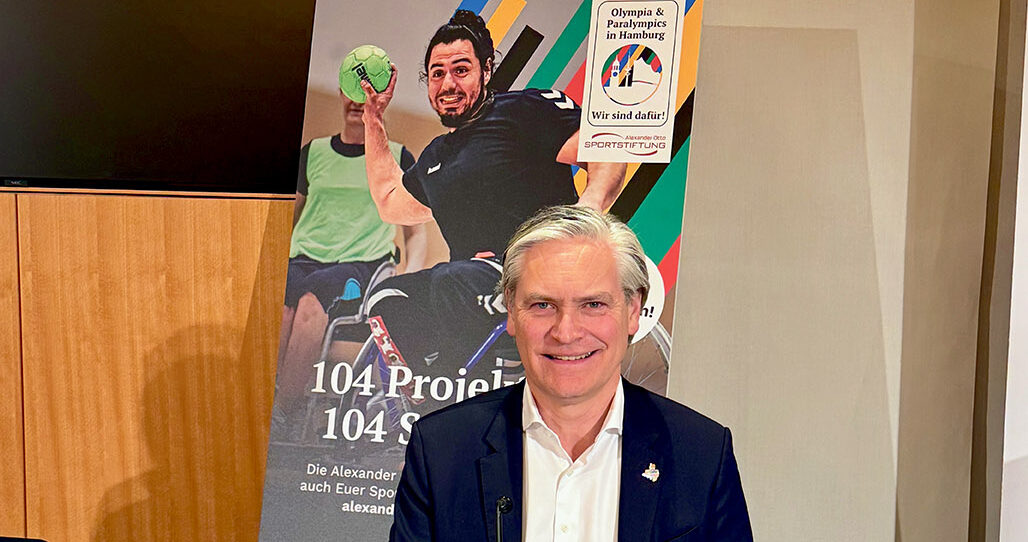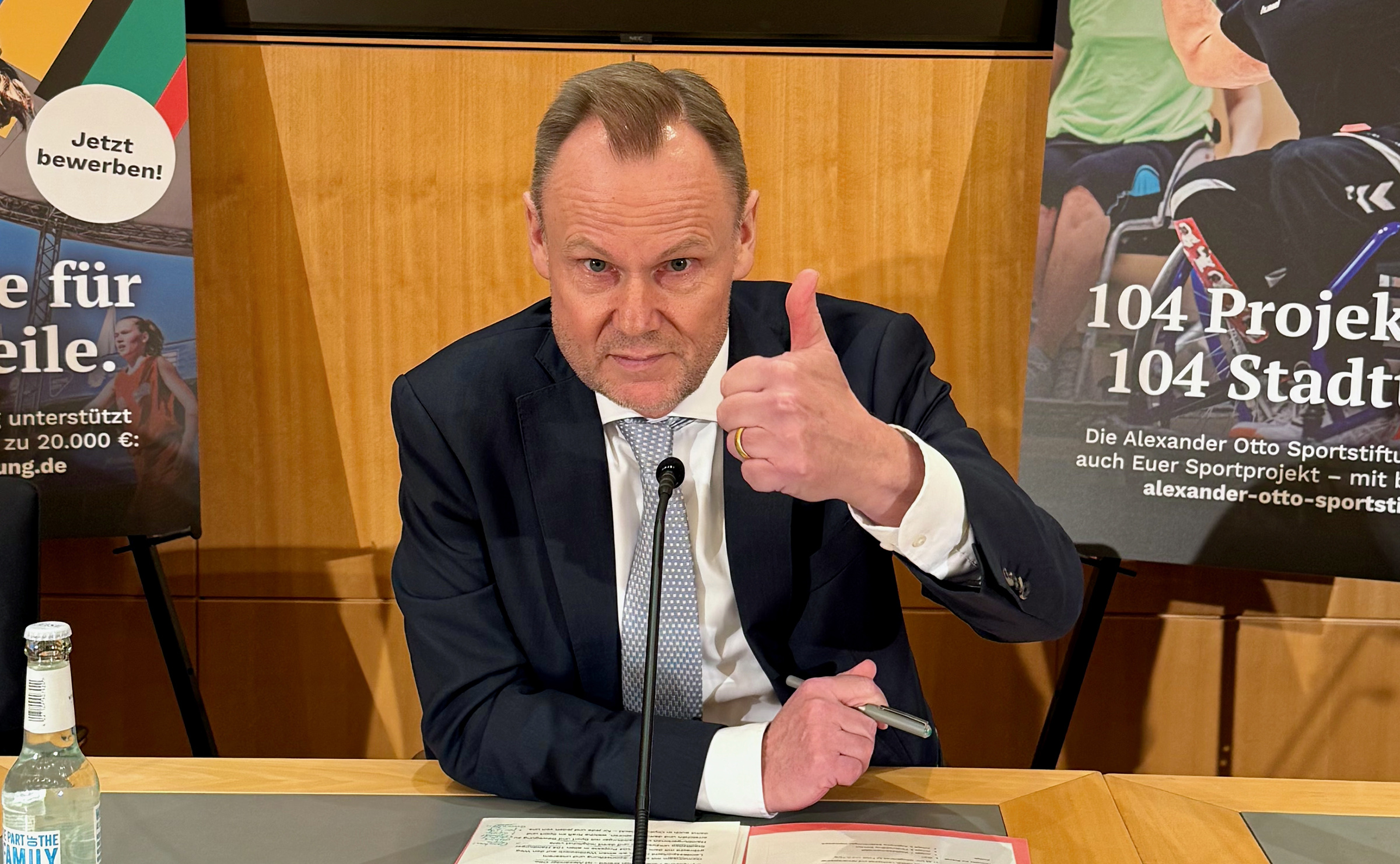Exklusivgespräch. Ein Blick hinter die Kulissen: Kultursenator Dr. Carsten Brosda über die neue Oper auf dem Baakenhöft, die jetzt stattfindenden Debatten und die Rolle von Kunst in der Stadt sowie persönliche Glücksmomente
Das geplante neue Opernhaus in der Hamburger HafenCity auf dem Baakenhöft sorgt für hitzige Debatten. Im Gespräch mit der HCZ HafenCity Zeitung nimmt Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien, Stellung zu den Vorwürfen, es gebe nur alibihafte öffentliche Diskussionen, der Projektprozess sei nicht demokratisch und er werde der Stadtgesellschaft aufgezwungen. Er spricht auch über die Finanzierung, das historische Erbe des Standorts und erklärt, warum eine neue Oper stadtgesellschaftlich genau das richtige „Signal des Aufbruchs“ für Hamburg ist. Lesen Sie mal!
Foto oben: Kultursenator Carsten Brosda auf der Oberhafenbrücke in der HafenCity: „Ich glaube, in einem Saal zu sitzen und eine klassische Oper mit allen Sinnen zu erleben, beeindruckt die Menschen. Das haben wir auch bei der Elbphilharmonie gesehen. Was sich bis heute am besten verkauft, sind nicht die Pop- oder Jazzkonzerte, sondern die klassischen Konzerte. Auch Menschen, die vorher nicht hingegangen sind, wollen jetzt dorthin. Das ist mein Anspruch auch für die Oper.“ © Marcelo Hernandez für Behörde für Kultur und Medien
Herr Brosda, auf Social Media werden kritische Stimmen zur neuen Oper auf dem Baakenhöft oft als „links-grüne Blase“ beschimpft. Wie gehen Sie mit der Kritik am Opernprojekt wie jüngst auch bei der Diskussion in der Patriotischen Gesellschaft um? Ich würde der Kritik auf keinen Fall irgendwelche Etiketten zuordnen. Ich glaube, es gibt nicht die eine Kritik, sondern vor allem Fragen, die man an das Projekt hat, und ein paar kategorische Einwände. Bei den Einwänden wünsche ich mir, dass man nicht aus Prinzip „Nein“ sagt, sondern sich auch mit den Inhalten beschäftigt. Es gibt diejenigen, die fragen, ob man das Geld dafür ausgeben muss. Ich kann ihnen klar sagen, dass jede andere Version, um die Oper in Hamburg spielfähig zu halten, für die Stadt wesentlich teurer wäre. Dann gibt es die Frage, ob man an dem Standort Baakenhöft nicht etwas anderes entwickeln sollte. Ich glaube, man wird im Laufe des Qualifizierungsverfahrens mit den fünf Architekturbüros sehen, dass wir eine gute, öffentlich nutzbare Fläche bekommen werden, auf der auch attraktive und offene Freiflächen entstehen werden. Es gibt auch geschichtspolitisch motivierte Fragen, weil der Ort kolonial belastet ist. Hierzu kann man sagen, dass dies den gesamten Baakenhafen und nicht explizit das Baakenhöft betrifft. Wir haben im Dekolonisierungskonzept bereits beschlossen, dass der Baakenhafen einer kritischen Kommentierung bedarf und diese auch bekommen soll. Ich würde also nie sagen, dass jemand, der Kritik hat, dieses oder jenes Etikett trägt. Ich würde sagen: „Lass uns drüber reden.“ Ich bin mir sicher, wir haben gute Argumente, warum unser Vorschlag für die Stadt gut ist.
»Eine klassische hamburgische Lösung wäre gewesen, das Grundstück an einen großen Konzern zu verkaufen, der dort seine Zentrale errichtet. Das wäre sicherlich der ökonomisch vorteilhaftere, aber nicht der bessere Deal für die Gestaltung eines öffentlichen Ortes gewesen.«
Dr. Carsten Brosda
Warum sind Sie persönlich so überzeugt von diesem Projekt? Es gibt für mich insbesondere zwei Gründe. Der eine ist ein praktischer, hamburgischer: Es ist für das Stadtsäckel deutlich günstiger, die Stiftung neu bauen zu lassen, als den Bestandsbau selbst so zu sanieren, dass er den heutigen Standards entspricht. Wir sparen uns ferner bei einem Neubau eine lange Schließzeit der heutigen Oper, die es bei einer Generalsanierung bräuchte. Ich habe gerade in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, dass die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker den Kardinalfehler für die extrem teure Opernsanierung in Köln darin sieht, dass man damals nicht den Mut hatte, neu zu bauen, weil das viel schneller und preiswerter gewesen wäre.
Der zweite Punkt ist ein inhaltlicher. Ein Neubau gibt uns die Chance, ein Opernhaus neu zu denken. Wir können überlegen, was ein Opernhaus im 21. Jahrhundert ausmacht. Wie gestalten wir Foyers und organisieren die betrieblichen Abläufe? Wie bauen wir ein Haus, das sich für die Stadtgesellschaft öffnet, das niedrigschwellig und einladend ist? Und wie führt diese bauliche Gestaltung zu einer Veränderung dessen, was im Haus stattfindet? So wie wir es bei der Elbphilharmonie erlebt haben, bin ich mir sicher, dass dies auch bei der neuen Oper gelingen kann.
Apropos Elbphilharmonie: Dort haben Pop, Jazz und viele unterschiedlichste Musikrichtungen Einzug gehalten. Wird es so etwas auch in der Oper geben? Wird es eine Disco in der Oper geben? Um es praktisch zu beantworten: Am ersten Wochenende im Oktober gab es zur Spielzeiteröffnung der Hamburgischen Staatsoper an der Dammtorstraße eine Party über vier Stockwerke, weil die neue Intendanz zu ihrem Auftakt nicht nur Klassik gespielt hat, sondern auch Disco und Egerländer Blasmusik. Die Eröffnungsgala selbst begann mit einer Hölderlin-Liedvertonung und endete mit einem Udo-Jürgens-Stück. Ich glaube nicht, dass man solche Häuser als Partyzone grundsätzlich neu denken muss. Aber die Frage, welche musikalischen Angebote man dort entwickeln kann, wird künftig anders zu beantworten sein als mit der ausschließlichen Fokussierung auf die große Opernliteratur der letzten 200 bis 300 Jahre.
Und wenn man sich die Programmatik der neuen Opernleitung für die Spielzeit 2025/26 anschaut, sind die da auf einem spannenden Weg. Der neue Generalmusikdirektor Omer Meir Wellber arbeitet mit dem Theater Schmidts Tivoli an einem Musikprojekt zusammen, das nächstes Jahr auf dem Kiez Premiere feiert. Es gibt viele Möglichkeiten, die Bandbreite des Musiktheaters zu erweitern. Das neue Haus kann das besser und unter besseren Arbeitsbedingungen als das jetzige. Ich bin der Meinung, dass man Exzellenz im Musiktheater mit der Frage verbinden muss, wie man die gesamte Stadtgesellschaft einlädt, sich das auch einmal anzusehen und zu erleben. Denn ich glaube, in einem Saal zu sitzen und eine klassische Oper mit allen Sinnen zu erleben, beeindruckt die Menschen. Das haben wir auch bei der Elbphilharmonie gesehen. Was sich bis heute am besten verkauft, sind nicht die Pop- oder Jazzkonzerte, sondern die klassischen Konzerte. Auch Menschen, die vorher nicht hingegangen sind, wollen jetzt dorthin. Das ist mein Anspruch auch für die Oper.

Einige Kritiker werfen dem Stifter des Projekts, Klaus-Michael Kühne, vor, die NS-Verstrickungen seiner Familie und seines Unternehmens Kühne + Nagel nicht transparent durch Wissenschaftler aufgearbeitet zu haben. Wie stehen Sie dazu? Das Unternehmen hat sich zu seiner Vergangenheit bekannt und hat meines Wissens auch in den Entschädigungsfonds für NS-Unrecht der deutschen Wirtschaft eingezahlt. Der Vorwurf, Herr Kühne würde sich gar nicht dazu verhalten, trifft aus meiner Sicht nicht zu. Was fehlt, ist jedoch eine unabhängige wissenschaftliche Aufarbeitung. Wir raten allen Unternehmen dazu, dies zu tun, weil es geboten ist, sich unvoreingenommen und unabhängig mit der eigenen Vergangenheit zu beschäftigen.
Ich bin jedoch erstaunt, mit welcher Vehemenz diese Forderung an eine Person herangetragen wird, während wir übersehen, wie groß die Lücken als Gesellschaft insgesamt bei diesem Thema noch sind. Die Aufarbeitung der Kulturverwaltung Hamburgs während der NS-Zeit habe ich zum Beispiel selbst erst im letzten Jahr in Auftrag gegeben, was keiner meiner Vorgänger in dieser Form getan hat. Kürzlich habe ich im Spiegel ein Interview mit dem Historiker Joachim Scholtyseck gelesen, der sich das Unternehmen Porsche während der NS-Zeit angesehen hat. Der sagte, 85 Prozent der deutschen Unternehmen hätten ihre NS-Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet. Das zeigt, dass die Aufgabe viel größer ist, als sie manchmal dargestellt wird, und man so tut, als müsste nur Kühne + Nagel das tun, um die Sache abzuschließen.
Verknüpfen Sie die NS-Vergangenheit des Unternehmens mit dem Opernprojekt? Unser Rat ist, wie schon gesagt, eine unabhängige wissenschaftliche Aufarbeitung vornehmen zu lassen, das gilt auch für Kühne + Nagel. Ich finde aber nicht, dass diese beiden Dinge miteinander verknüpft werden müssen, nach dem Motto: „Das eine darf nur geschehen, wenn das andere geschehen ist.“ Für mich sind es zwei unabhängige Punkte, auch wenn sie in der Öffentlichkeit miteinander verknüpft werden. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, einen Vertrag schließen zu wollen nach dem Motto: „Ich nehme ein Geschenk nur an, wenn du vorher noch folgende Bedingungen erfüllst.“ Meiner Erfahrung nach ist das generell für Beziehungen nicht gut.
Vita Dr. Carsten Brosda
ist seit 2017 Senator für Kultur und Medien in Hamburg sowie seit 2025 Mitglied im Programmrat für das neue Grundsatzprogramm der SPD. Seit 2020 ist er zudem Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Hamburg und die Künstler:innen und Kulturschaffenden schätzen Brosda, ist der 51-Jährige doch ein verlässlicher Vertreter für die Freiheit und Vielfalt von Kunst und Kultur sowie ein pfiffiger nachhaltiger Finanzbeschaffer. In den rund fünf Jahren seit Beginn der Pandemie im März 2020 und den existenziellen Krisen von Clubs, Künstler:innen und Kulturveranstaltern hat er sich erfolgreich gekümmert und nachhaltig Finanzmittel organisiert. Aktuell hat Brosda für den Senat erfolgreich mit dem Stifter und Milliardär Klaus-Michael Kühne die Schenkung eines neuen Operngebäudes auf dem Baakenhöft vereinbart.
Carsten Brosda, geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen, wurde nach dem Studium der Journalistik und Politikwissenschaft an der Universität Dortmund und einem Volontariat bei der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ) 2007 mit einer Arbeit über „Diskursiven Journalismus“ promoviert. Er war unter anderem Leiter der Abteilung Kommunikation des SPD-Parteivorstandes und arbeitet seit 2011 in Hamburg – zunächst als Leiter des Amtes Medien und ab 2016 als Staatsrat für Kultur, Medien und Digitalisierung im Olaf-Scholz-Senat. Seit Februar 2017 ist Brosda Senator für Kultur und Medien, erst im sogenannten Scholz-II-Senat, dann in den folgenden von der SPD geführten rot-grünen Regierungen der Tschentscher-Senate I und II sowie seit dem 7. Mai 2025 im Tschentscher-Senat III.
Carsten Brosda ist verheiratet, lebt im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel und hat zwei Töchter.
Manche Kritiker wünschen sich, dass eine neue Oper als Leuchtturmprojekt in der Innenstadt entsteht. Ich könnte jetzt antworten: „Die Oper entsteht doch in der Innenstadt.“ Für jemanden wie mich, der erst vor 15 Jahren nach Hamburg gezogen ist, fühlt sich die HafenCity wie ein Teil der Innenstadt an. Die HafenCity ist immer eine Erweiterung der inneren Stadt gewesen, so habe ich auch Henning Voscherau verstanden, als er 1991 die Idee zur HafenCity entwickelt hat. Ich glaube, in wenigen Jahren wird die Frage gar keiner mehr stellen, weil die HafenCity selbstverständlich als Bestandteil der Innenstadt angesehen wird. Viele müssen sich erst noch daran gewöhnen, dass es hinter der Speicherstadt noch etwas gibt. Wenn man auf den Stadtplan schaut, sieht man, dass der Standort auf dem Baakenhöft absolut zentral ist. Es gibt eine U-Bahn-Station und Busse in der Nähe, und die S-Bahn ist auch nicht weit weg. In ein paar Jahren, und ganz sicher in den kommenden zehn Jahren bis zur Realisierung des Projekts, werden wir völlig anders darauf schauen. Und dann haben wir eine Innenstadt, die größer ist als der historische Kern.
Diejenigen, die die Oper näher am alten Standort bauen wollen, haben außerdem das Problem, dass wir in der historischen Innenstadt keine Grundstücke für einen Neubau haben. Auf dem Grundstück der heutigen Oper zu bauen, ist erstens durch den Denkmalschutz ausgeschlossen, und zweitens könnte man die Bedarfe einer modernen Oper, wie den viermal so großen Hinterbühnenbereich, dort nicht unterbringen. Die Idee, die denkmalgeschützte Oper abzureißen und neu zu bauen, wie sie in Düsseldorf diskutiert wird, würde in Hamburg nicht funktionieren.
In der Ausschreibung des Architektenwettbewerbs ist an der Stelle des heutigen Gebäudes der früheren Märchenwelten die Schaffung eines Parks als „klimakühlende Verlängerung“ des Lohseparks vorgesehen. Kritiker bezeichnen dies als „Alibi-Grünstreifen“ mit neuem Operngebäude und gepflasterter Ufergestaltung wie auch sonst in der HafenCity. Diese Verlängerung des Parks ist schon in den ersten Masterplänen vorgesehen und dient als Frischluftschneise. Was sich auch in den Unterlagen findet und was auch meiner Vorstellung entspricht, ist, dass dort nicht in erster Linie eine spektakuläre „Signature-Architektur“ entstehen muss. Ich würde mir Entwürfe wünschen, die die Spitze des Baakenhöfts als Park denken. Das heißt, dass man sich bis ganz zur Spitze hinweg im Grünen bewegen kann und sich in diesem Grün ein Opernhaus befindet. Das würde ich mir wünschen, auch weil ich diejenigen verstehe, die sagen, die HafenCity verträgt noch mehr Grün.
Wir haben als Senat die Entscheidung getroffen, dass dort ausschließlich das Opernhaus mit den Freiflächen entstehen soll, um genau die Möglichkeit zu haben, einen attraktiven und hoffentlich sehr grünen Freiraum gestalten zu können, der über den Parkstreifen hinausgeht. Eine klassische hamburgische Lösung wäre gewesen, das Grundstück an einen großen Konzern zu verkaufen, der dort seine Zentrale errichtet. Das wäre sicherlich der ökonomisch vorteilhaftere, aber nicht der bessere Deal für die Gestaltung eines öffentlichen Ortes gewesen.
Kritiker bemängeln auch, dass es seit der Bekanntgabe des Projekts im Februar 2025 keine vom Senat initiierte öffentliche Diskussion gab. Wie wollen Sie so Begeisterung für die neue Oper schaffen? Ich finde nicht, dass nicht darüber gesprochen wird. Jedenfalls kann ich mich an viele Momente erinnern, in denen wir darüber gesprochen haben, und es werden noch viele folgen. Es gab Landespressekonferenzen zum Ort, ich gebe regelmäßig Interviews dazu und nehme Veranstaltungen wahr. Die entscheidende Frage ist doch: Sind wir bereit zu sagen, das ist eine Chance, aus der wir etwas machen, oder stellen wir die Bedenken in den Vordergrund und gehen davon aus, dass alles sowieso nichts wird? Ich glaube, dass dies die grundsätzliche Frage ist, der wir uns stellen sollten – und zwar nicht, indem der Staat eine öffentliche Diskussion organisiert, sondern die Stadtgesellschaft lebendig diskutiert. Und das passiert. Ich glaube, es ist wichtig für eine Demokratie, dass neben der parlamentarischen Befassung auch ein öffentlicher Raum entsteht, in dem der Senat ein Gesprächspartner ist. Wenn wir selbst eine Reihe von Veranstaltungen machen würden, würde uns sicher vorgeworfen werden, dass wir eine Marketingkampagne für das Projekt machen würden.
Es haben bereits eine Reihe von Veranstaltungen stattgefunden. Die Bürgerschaftsabgeordneten haben diskutiert, das Netzwerk HafenCity e. V. und die HafenCity Universität haben etwas gemacht und auch die Patriotische Gesellschaft von 1765. Und wir diskutieren das Projekt im Ausschuss für Kultur und Medien und in der Bürgerschaft. Ich finde, dass das die Stadt gerade sehr lebendig diskutiert. Und es ist richtig, dass wir so lebhaft diskutieren. Das Gespräch macht das Projekt hoffentlich besser, und auch die Kritik daran macht das Projekt hoffentlich besser, und wir können viele Fragen im Gespräch klären.

Die Hamburger Architektenkammer und Vertreter des Denkmalschutzes kritisieren das Vorgehen als „nicht demokratisch“. Würden Sie es im Rückblick anders machen? Ich finde, das trifft nicht zu. Wir reden über ein privates Bauvorhaben. Dafür gelten nicht die gleichen Regularien wie für öffentliche Architektenwettbewerbe. Es wurde ein anderes Verfahren gewählt, das mit dem Oberbaudirektor und der Stadtentwicklungsbehörde abgestimmt wurde. Zu sagen, es sei ein „nicht demokratisches“ Verfahren, finde ich schwierig, weil es am Ende infrage stellt, dass der Senat legitimiert ist, auf Grundlage unserer Rechtsordnung zu handeln. Senatsbehörden machen regelmäßig Vorschläge, die dann im gewählten Parlament diskutiert werden, und gestalten Verfahren. Wenn wir die repräsentative Demokratie mit solchen Worten in Zweifel ziehen, landen wir bei ganz anderen Problemen als bei der Frage, ob wir ein Opernhaus bauen oder nicht.
In der Patriotischen Gesellschaft sangen charmant-listig zu Beginn der zweiten Operndebatte, nach der Netzwerk-Dialog-Premiere in der HafenCity, Sänger:innen vom Denkmalverein und der Staatsoper Verdis „Chor der Gefangenen“. Sind Sie und der Senat „Gefangene“ des geschenkten Opernhauses? Ich glaube, dass das die Interpretation war, die die Singenden uns nahelegen wollten. Es ist doch erst einmal schön, wenn Menschen dazu animiert werden, durch Vorschläge, die wir machen, sich mit Kunst zu befassen. Und zweitens, fand ich, hat dann ja auch Willfried Meier, der Vorsitzende der Patriotischen Gesellschaft, sehr maliziös auf die textliche Komponente hingewiesen, worum es denn in Verdis Oper Nabucco im „Chor der Gefangenen“ tatsächlich geht: dass der Gedanke fliegen möge und dass der Chor der Gefangenen die Hymne derjenigen ist, die in Italien die Demokratie und den Aufbruch in eine neue Zeit angestrebt haben. Und diese Interpretation gefällt mir tatsächlich besser. Wenn man damit kontrafaktisch dafür geworben hat, dass wir in eine neue Zeit aufbrechen, ist das doch schön.
Viele Kritiker haben, auch in der Debatte in der Patriotischen Gesellschaft, den Eindruck, dass, egal, was man an Gegenargumenten einbringt, sie nicht beachtet würden und so eine Politikmüdigkeit entstehen kann. Ist der Drops schon gelutscht? Wenn man grundsätzlich diskutieren will, ob Hamburg eine Oper braucht oder nicht, hätte ich nichts dagegen, wenn der Drops gelutscht wäre – und zwar seit fast 350 Jahren, seit Hamburg sich entschieden hat, eine Oper zu haben. Das kann man diskutieren, würde ich jedoch nicht revidiert wissen wollen. Die Diskussion habe ich aber bisher noch nicht wahrgenommen. Auch wenn der eine oder andere Vorschlag sagt: „Lasst das mal mit der neuen Oper. Die rund 150 Millionen Euro, die ihr als Stadt dafür ausgeben wollt, geben wir lieber für was anderes aus.“ De facto heißt das, dass wir irgendwann aufhören, eine Oper zu besitzen, weil wir dann ja noch nicht einmal die Mittel generieren würden, um den alten Standort zu sanieren.
Die Frage aber, ob wir als Stadt den Vertrag annehmen wollen, den wir über Jahre hinweg mit der Kühne-Stiftung verhandelt haben, diese Frage ist nicht entschieden. Das diskutieren wir derzeit. Wir haben der Stadtgesellschaft einen guten Vorschlag gemacht. Einige meinen, dass wir die Vertragsverhandlungen vorher stadtöffentlich hätten diskutieren sollen. Ich habe eine grobe Vorstellung davon, was dabei rausgekommen wäre, wenn wir unklare Bedingungen kommuniziert hätten, unter denen die Kühne-Stiftung unter bestimmten Voraussetzungen möglicherweise einen Opernneubau finanzieren würde …

Es wäre zerredet worden? Das wäre noch freundlich formuliert. Es wäre ganz sicher gescheitert. Wir haben stattdessen einen Vorschlag verhandelt, den wir jetzt bewerten können. Die konkreten Fragen werden jetzt diskutiert: Was bedeutet der Vorschlag in der Umsetzung der Architektur und der Freiraumplanung auf dem Baakenhöft? Wie sieht die Gestaltung innerhalb der HafenCity aus? Kommt das neue Opernhaus überhaupt? Das sind alles Entscheidungen, die in der Zukunft noch in einzelnen Punkten zu treffen sind. So weit sind wir noch längst nicht.
Anwohner und Initiativen in der HafenCity kritisieren, dass es keine Konzepte für öffentliche Orte für junge Menschen gibt. Wenn ich ehrlich bin, stimmt das ja so nicht ganz. Mit dem Urbaneo – das junge Architekturzentrum hat vor wenigen Monaten ein Angebot für Jugendliche eröffnet, und es gibt im Vergleich zu anderen Stadtteilen viele öffentliche Flächen. Ich glaube, junge Leute wollen vor allem einen Ort, an dem sie bei sich sein können, nicht einen, an dem sie bespaßt und betreut werden. Und diese Orte entstehen im öffentlichen Raum und in der HafenCity ganz konkret rund um den Oberhafen, an den Flussufern und künftig auf dem neuen Stadtteil Grasbrook. Da finde ich es keine schlechte Vorstellung, dass junge Menschen später auf dem Baakenhöft der neuen Oper buchstäblich aufs begrünte Dach steigen können.
»Ich glaube sehr fest daran, dass sich die Zukunft unserer Gesellschaft an den analogen Orten entscheidet, nicht an den digitalen.«
Dr. Carsten Brosda
Ist die Oper nicht ein analoger Kulturort von gestern, in Zeiten von Handy- und Tablet-Nutzung? Das glaube ich nicht. Die Oper ist ein kulturelles Ganzkörpererlebnis wie wenig anderes. Gerade in unseren digitalen Zeiten haben diese analogen Orte eine unfassbare Kraft. Unsere Aufgabe ist es, auch junge Menschen davon zu überzeugen und sie in die Oper zu bekommen. Wenn sie einmal da sind, werden wir viele leuchtende Augen sehen. Ich glaube fest daran, dass sich die Zukunft unserer Gesellschaft an den analogen Orten entscheidet, nicht an den digitalen.
Sie setzen auf Intendant Tobias Kratzer und Generalmusikdirektor Omer Meir Wellber. Warum können beide frisches Leben ins Operngenre bringen? Die beiden brennen für die Kultur! Wer sie erlebt hat, nimmt zwei Menschen wahr, die mit jeder Faser daran arbeiten, relevante Kunst zu schaffen, aber auch Räume, in denen diese Kunst vermittelt wird und Kommunikation darüber entsteht. Omer Meir Wellber hat morgens sein erstes Konzert in der Elbphilharmonie gespielt, und abends war er mit seinem Akkordeon auf der Bühne von Schmidts Tivoli. Tobias Kratzer wollte uns mit seiner Eröffnungsmatinee zeigen: „Alles, was Oper kann …“ Und dann fand zwei Stunden lang, moderiert von Ina Müller, nichts statt, was jemals in einer Oper stattfand. Das ging bis hin zu einem Kunstpfeifer, der, zur Begleitung durch das Orchester, die Arie „Die Königin der Nacht“ aus Mozarts Oper „Zauberflöte“ pfiff. Und danach gab es auf allen Fluren der Hamburgischen Staatsoper eine Party zur Saisoneröffnung.
Die beiden haben erkennbar Lust, die Oper neu zu erfinden. Und sie haben mit ihrem Amtsantritt die Kommunikation der Staatsoper unter die Überschrift „Die neue Oper“ gestellt. Sie sagen: „Die neue Oper entsteht jetzt schon.“ Und sie wollen die Oper für alle öffnen. Ein Beispiel: Die Mailänder Scala hat neulich verkündet, dass die Leute wieder ordentlich gekleidet ins Opernhaus kommen sollen, idealerweise im Smoking. Am gleichen Tag hat die Hamburgische Staatsoper als Antwort darauf gepostet: „Come as you are.“ Das heißt, zieh das an, was du willst. Alles in Ordnung. Komm so, wie du bist, wie du dich wohlfühlst, dann fühlen wir uns hier alle gemeinsam wohl.
Welches ist Ihre Lieblingsoper? Da ich immer noch beeindruckt von der Saisonpremiere bin, ist es im Moment „Das Paradies und die Peri“, keine Oper im klassischen Sinn, sondern eher ein Oratorium. Tobias Kratzer hat es auf kluge Art und Weise verstanden, als Regisseur das Publikum einzubeziehen und zeitgemäße Diskurse mit hereinzuholen und trotzdem den Leuten nicht ein einfaches Erlösungsmuster zu geben. Er hat alle Besucherinnen und Besucher mit dem Bewusstsein entlassen, dass es eine Erlösung nirgendwo gibt. Das müsst ihr als Publikum in dieser Welt schon selbst lösen. Das war für mich intelligentes Musiktheater, das zudem gut inszeniert, gespielt und gesungen wurde. Das machte großen Spaß und Lust auf mehr. Ich habe mich an diesem Abend mal wieder in meiner Annahme bestätigt gefühlt, dass Oper eine extrem zeitgemäße und gegenwärtige Kunstform ist.
Was macht Sie glücklich? Abgesehen davon, dass es mich glücklich macht, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, machen mich die Momente glücklich, in denen ich spüre, dass gerade etwas Besonderes passiert. Das kann man nicht beschreiben, das ist die Magie des Augenblicks. Manchmal ist es ein Gitarrensolo, manchmal ein Dialog in einem Theaterstück, bei dem ich etwas begreife, das ich vorher nicht begriffen hatte, oder ich bin auf eine Art ergriffen, in der ich noch nicht ergriffen war. Ich glaube, nichts anderes schafft das so intensiv wie Kunsterlebnisse. Das sind Momente, in denen man ganz bei sich sein kann, obwohl man mit vielen anderen zusammen ist.
Das Gespräch führte Wolfgang Timpe