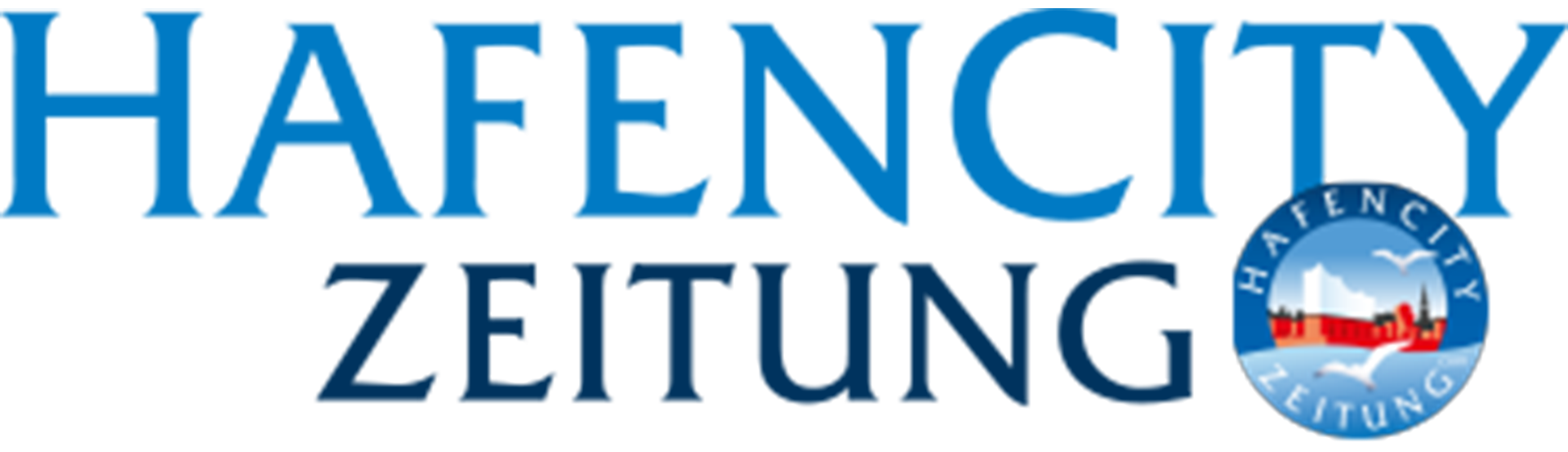Kolumnist Jan Ehlert erörtert in der Oktober-Ausgabe der HafenCity Zeitung in seiner „Literatur zur Lage“, #94, u.a. den Roman „Was wir wissen können“ von Ian McEwan und Wasserstoffbomben.
Was werden künftige Generationen einst über uns erzählen? Glaubt man dem Schriftsteller Ian McEwan, dann werden sie nicht gerade gnädig mit uns ins Gericht gehen. „Tag für Tag erzählt man uns von der Überschwemmung, den dunklen Zeiten, der Idiotie jener Tage, der Erderwärmung und, was alle ignoriert haben, diesen dummen Kriegen, den Tieren, die getötet wurden, und der Hautfarbe, die ihnen so wichtig war. Die Narren von einst“, so urteilen die Studierenden in McEwans neuem, großartigem Roman „Was wir wissen können“.
Foto oben: Das unbewohnte Bikini-Atoll in Mikronesien im Pazifischen Ozean, auf dem die USA zwischen 1946 und 1958 über 20 Atomtests durchführten. In Ian McEwans Roman „Was wir wissen können“ zünden die Russen im Jahr 2119 eine Wasserstoffbombe, und die Welt ist überflutet.© picture alliance / Reinhard Dirscherl
Er spielt im Jahr 2119. Durch den Klimawandel und durch eine riesige russische Wasserstoffbombe, die im Jahr 2042 über dem Ozean explodierte, sind große Teile der Welt überflutet. London, Rotterdam und auch Hamburg liegen tief unter dem Meeresspiegel. Die Überlebenden wohnen auf kleinen Inseln, die Vergangenheit interessiert sie kaum. Nur der Literaturprofessor Tom Metcalfe kann sie nicht vergessen, taucht ein in die Literatur seiner Zeit, auf der Suche nach einem verschollenen Gedicht aus dem Jahr 2014. Und versucht dabei auch zu verstehen, warum die Menschheit so zielstrebig auf die globale Katastrophe zusteuerte.
»Tag für Tag erzählt man uns von der Überschwemmung, den dunklen Zeiten, der Idiotie jener Tage, der Erderwärmung und, was alle ignoriert haben, diesen dummen Kriegen, den Tieren, die getötet wurden, und der Hautfarbe, die ihnen so wichtig war.«aus: Ian McEwans Roman »Was wir wissen können«
Der Titel „Was wir wissen können“ ist doppeldeutig: Er verweist auf unsere oft trügerische Sicht auf die Vergangenheit: Was wissen wir wirklich über die Zeit des 19. oder auch 20.Jahrhunderts? Er erinnert uns aber auch daran, was wir über unsere Gegenwart wissen können: Nur weil das politische Getöse immer lauter wird, wird das Zeitfenster, in dem wir noch etwas tun können, um den Klimawandel aufzuhalten, nicht größer. Wir müssen handeln, und zwar bald, allen gegenteiligen Behauptungen von US-Präsidenten zum Trotz.

Dass man auch im Kleinen etwas verändern kann, daran erinnert der US-amerikanische Autor Ocean Vuong in seinem ebenfalls großartigen Roman „Der Kaiser der Freude“. Seine Protagonisten sind Außenseiter der Gesellschaft, sie haben keine Macht, politisch etwas zu verändern. Aber sie haben die Möglichkeit, sich gegenseitig zu helfen. Sie schaffen es, auszublenden, dass sie unterschiedliche Weltanschauungen haben, sondern sind füreinander da, wenn einer von ihnen zusammenzubrechen droht. Eine wunderbare Erinnerung daran, dass eine kleine liebevolle Geste oft mehr bewirkt als große Reden. Dass Menschlichkeit viel größer als Hass ist. Wenn wir diese Botschaft an spätere Generationen weitergeben, dann werden sie vielleicht selbst liebevoller an uns zurückdenken. Das wird den Klimawandel nicht aufhalten, aber es wird unsere – und auch spätere – Welten sehr viel lebenswerter machen. Jan Ehlert
_____________________________
Jan Ehlert lebt in der HafenCity. Seine Passion sind Bücher. Er schreibt monatlich für die HafenCity Zeitung seine Kolumne »Literatur zur Lage«. © Privat