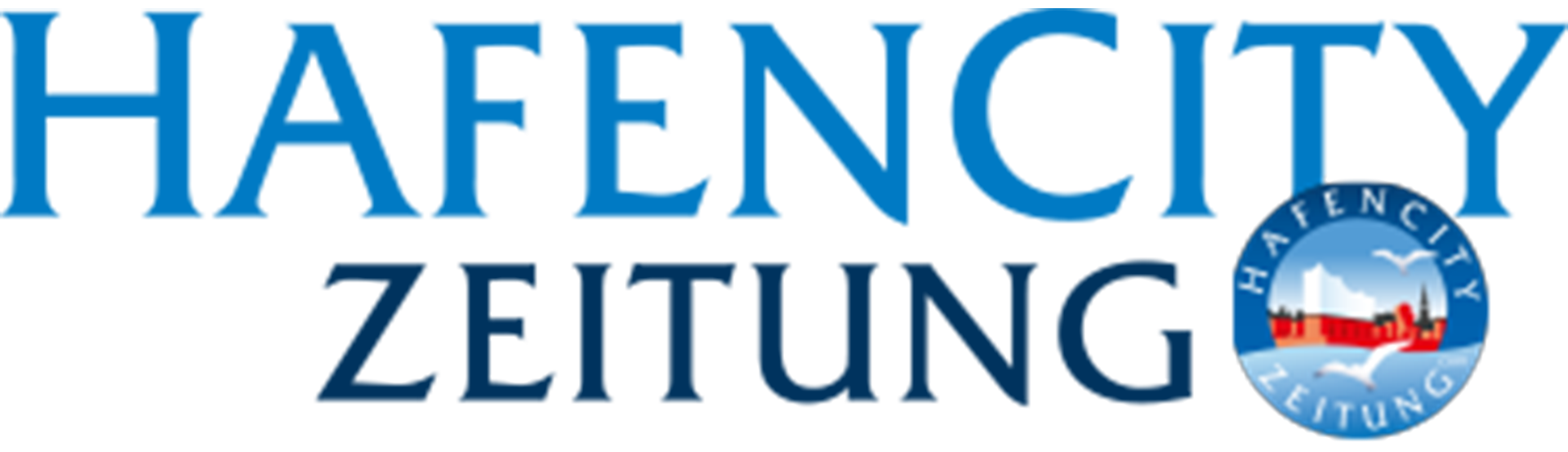Interview. Matthias Iken, stellvertretender Chefredakteur des »Hamburger Abendblatts«, über Innenstadt, HafenCity und Architektursünden
Er ist ein Opinion Leader, ein Mann mit Einfluss in der Freien und Hansestadt Hamburg: Matthias Iken, stellvertretender Chefredakteur des „Hamburger Abendblatts“, das in der Funke Mediengruppe erscheint. Seit 16 Jahren berichtet und kommentiert der studierte Politologe und Publizist das Politik- und Gesellschaftsgeschehen in der Elbmetropole. Sein Steckenpferd ist die Stadtplanung. Die HafenCity Zeitung sprach mit ihm über Glanz und Elend in der neuen erweiterten Innenstadt, über City und HafenCity sowie Architektursünden und darüber, warum er Hamburger Architekten schätzt: „Sie haben halt ein besonderes Gespür für die Stadt.“ Lesen Sie mal.
Foto oben: Matthias Iken am Lieblingsort Magellan-Terrassen: „Beim Thema Olympia hat Hamburg freiwillig das Schicksal der Selbstverzwergung gewählt.“ © Catrin-Anja Eichinger
Herr Iken, Sie beobachten als Journalist seit Jahrzehnten die Entwicklung Hamburgs und vor allem auch der HafenCity. Ihre Lieblingsthemen sind unter anderen Stadtentwicklung, Städtebau und die urbane Entwicklung Hamburgs als Metropole. Was ist aus Ihrer Sicht die größte Bausünde der vergangenen Jahre, die sich Hamburg und die HafenCity geleistet haben? Bausünde kann auch bedeuten, dass man ein Gebäude abgerissen hat, das man besser erhalten hätte. Ich stelle mir immer häufiger die Frage: Menschenskinder, hätten wir das nicht besser erhalten sollen? Jüngstes Beispiel sind für mich die Gänsemarktpassage in der Innenstadt oder der „Weiße Riese“, das Euler-Hermes-Hochhaus in Bahrenfeld. Das sind Gebäude, die man zeitgemäß hätte umwidmen können. Ich fürchte, dass wir in 20 Jahren die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und bedauern werden, welche historische Bausubstanz in Hamburg vernichtet wurde.

Zählen für Sie auch die vier City-Hof-Hochhäuser am Klosterwall dazu, die man 2019 abgerissen hat? Da bin ich hin- und hergerissen. Auf der einen Seite waren sie städtebaulich spannend, andererseits war das Ensemble am Ende durch mangelnde Pflege so verhunzt, dass es in der Stadt wie ein Fremdkörper wirkte.
Und sie sind nun durch einen etwas gesichtslosen Backstein-Neubau ersetzt worden. Ja, es gab einen interessanten Entwurf der Hamburger gmp-Architekten um Volkwin Marg, der zeigte, was man aus dem Altbau hätte machen können. Erst jetzt beginnt man zu begreifen, dass das Alte, Gewachsene doch einen zweiten und dritten Blick verdient hat.
Wenn Sie Hamburg mal mit den europäischen Metropolen Paris, London, Madrid, Barcelona, Rom oder auch Kopenhagen und Stockholm vergleichen: Was haben die, was Hamburg nicht hat? Sie haben vor allem die Funktion, Hauptstadt zu sein. Das fehlt uns in Hamburg. Wir sind eine Second City, die zweite Stadt nach Berlin, vergleichbar mit Barcelona nach Madrid. Viele europäische Staaten konzentrieren sich auf ihre Hauptstadt, dann kommt lange nichts, und erst dann kommt die zweitgrößte Stadt. Insofern hat Hamburg eine Hybridstellung.
VITA Matthias Iken ist seit 2008 Stellvertretender Chefredakteur des »Hamburger Abendblatts«, das in der Funke Mediengruppe erscheint und Hamburgs größte Verlagsmedien-Marke ist. Der 53-Jährige studierte Politik und Publizistik in Münster und Växjö, Schweden. Seine journalistische Laufbahn führte den gebürtigen Wildeshausener (bei Bremen) nach jugendlichen Lokalredaktions-Stationen – mit drei (!) Zeitungen im kleinen Ort – u. a. zur »Welt«-Gruppe, wo er ab 2004 Leiter der Hamburg-Redaktion war, bevor er dann zum »Abendblatt« wechselte. Im Herbst erscheint von ihm ein neues Buch über Hamburgs Stadtentwicklung. Matthias Iken ist verheiratet, hat drei Kinder (11, 15 und 17 Jahre) und lebt in Hamburg-Othmarschen.
Was macht Hamburg weltweit so attraktiv? Wir sind mit fast zwei Millionen Einwohnern am ehesten vergleichbar mit Barcelona, ein wenig auch mit Marseille, das aber kleiner ist. Hamburg hat enorme Pluspunkte: die Lage am Wasser, die Elbe, die Binnen- und Außenalster, die Bille, die Fleete und Kanäle. Das baukulturelle Erbe sowie die Geschichte und Tradition des Hafens, der seit über 800 Jahren unheimlich viel Input liefert. Andererseits ist mir Hamburg oftmals zu betulich und zu selbstverliebt, was sich inzwischen auf die Stadt nachteilig auswirkt. Das Geschwätz von der schönsten Stadt der Welt mag manchen das Herz wärmen, aber am Ende hindert es uns, größere Ziele anzustreben und zu erreichen.
Was fällt Ihnen auf, wenn Sie die Innenstädte dieser Metropolen mit unserer klassischen City an der Binnenalster und der HafenCity an der Elbe, der neuen Hamburger Innenstadt, vergleichen? Wir haben auf jeden Fall eine Innenstadt, die auf der einen Seite städtebaulich und wegen ihrer Lage an der Binnenalster sehr attraktiv ist. Auf der anderen Seite ist sie zugleich besonders gefährdet, weil sie eine sehr einseitige Struktur hat. Man will das jetzt im Kleinen mit Wohnen und Kultur nachbessern, doch das reicht nicht. Auch eine attraktive Gastronomie entwickelt sich viel zu langsam. Die klassische Innenstadt hat es schwer und wird es noch zunehmend schwerer haben, wenn in Kürze das Westfield Hamburg-Überseequartier eröffnen wird. Der Zweckoptimismus der Innenstadt-Kaufleute ist gut, doch ich fürchte, dass das Überseequartier der City noch einmal deutlich Passanten- und Konsumentenströme abspenstig macht. Und das in einer Situation, in der sich viele Händler in der Innenstadt weitere Rückgänge nicht leisten können.
Was zeichnet denn die anderen Innenstädte der Metropolen London, Paris oder Barcelona aus? Wir sollten nicht so vermessen sein, uns mit London oder Paris zu vergleichen, die spielen in einer ganz anderen Liga. Ich sehe uns am ehesten auf Augenhöhe mit Barcelona. Und da fallen mir sofort die Olympischen Sommerspiele 1992 ein, die die katalanische Metropole komplett aufgewertet haben. Beim Thema Olympia hat Hamburg freiwillig das Schicksal der Selbstverzwergung gewählt. Die Hamburger wollten den Krach und die Baustellen nicht, um es weiterhin hübsch und gemütlich zu haben. Das war eine klare Ansage, dass Hamburg klein bleiben und keine wirkliche Weltstadt werden wollte. Barcelona hat sich erst durch Olympia 1992 entwickelt – wie auch das Dorf München durch Olympia 1972 internationale Attraktivität gewonnen hat. Heute kennen im Ausland viele München besser als uns. Hamburg hat viele Chancen, aber die Stadt neigt dazu, ihre Chancen nicht zu nutzen.
Sie sind göttlicher Oberbaudirektor und können ein Gebäude zurückbauen und an gleicher Stelle ein neues errichten. Wo würden Sie was für ein Objekt neu bauen? Ein Gebäude, das dringend neu entwickelt werden muss, ist das Objekt mit der Zentrale der Hamburg Commercial Bank (HCOB) am Gerhart-Hauptmann-Platz in zentraler Innenstadt-Lage. Der Platz ist chronisch untergenutzt, hätte aber mit seinem Zugang zum Thalia Theater und dahinter der Binnenalster alle Möglichkeiten, ein innerstädtischer Mittelpunkt zu sein. Wenn es gelänge, in das HCOB-Gebäude eine interessante und vielfältige Nutzung hineinzubringen, würde das viele Menschen anlocken. Von einem attraktiven, neu entwickelten Gerhart-Hauptmann-Platz würde die gesamte City profitieren. Auch hier gab es schon einmal spannende Ideen der Academy for Architectural Culture. An dem Ort müsste man etwas ganz Neues entwickeln.
Kommen Hamburger Architekten mit ihren Ideen städteplanerisch und städtebaulich zu selten zum Zuge? Die bekommen schon Aufträge, aber vielleicht zu selten. Das verwundert vor dem Hintergrund, dass es ja etwa mit Volkwin Marg Hamburger Architekten waren, die zum Beispiel die Neuentdeckung des Wassers und von Wasserlagen in den 70er-Jahren mitgeprägt haben. Hamburger haben ein besonderes Gespür für die Stadt, und ich würde mir wünschen, dass man hiesige Architekten mit ihren Ideen ein wenig stärker zum Zuge kommen lässt, weil sie Stadt einfach verstehen.

Seit Januar 2017 ist die Elbphilharmonie Hamburgs neues Wahrzeichen, das nach einjährigem Baustillstand vom damaligen Ersten Bürgermeister Olaf Scholz gerettet und vollendet wurde. Jetzt haben wir beim 245 Meter hoch geplanten Elbtower, des Bundeskanzlers Abschiedsgeschenk an Hamburg, seit knapp einem halben Jahr Baustillstand, weshalb der aktuell 100 Meter hohe Rohbau „Kurzer Olaf“ genannt wird. Mögen Sie ästhetisch, städtebaulich und stadtplanerisch den Elbtower? Wieder eine doppelte Antwort. Man wollte einerseits mit dem Baubeschluss des Elbtowers 2017 einen städtebaulichen Abschluss schaffen, wie er schon im Masterplan der Stadt vorgesehen war. Da hat der Elbtower, wenn man die Stadtsilhouette von der südlichen Elbseite sieht, eine gewisse Logik und könnte ein „Tor“ zur Innenstadt bilden. Andererseits sind Hochhäuser nun mal, rational betrachtet, ineffizient, zu teuer und ökologisch umstritten.
Und jetzt? Haben wir da einen 100 Meter hohen Torso stehen, den „Kurzen Olaf“, was das Allerschlimmste ist. Wir wären gut beraten zu versuchen, das Ding, dieses eigentlich ästhetische Hochhaus, zu Ende zu bauen und so vernünftig zu nutzen, dass es wirtschaftlich betrieben werden kann. Die HafenCity braucht an dieser Stelle einen sogenannten Schlussstein, einen Abschluss, weil sie sonst im Osten als Stadtteil einfach so auslaufen würde.
Sie haben in einer Elf-Punkte-Analyse die Dramen und Fehler rund um die insolvente Elbtower-Baufirma Signa Prime Selection beschrieben und zitieren Hamburger Investoren, die übernehmen wollen und zugleich fordern, dass die Stadt viel mehr Eigenaktivität für einen Weiterbau des Elbtowers entwickeln müsste. Hand aufs Herz: Glauben Sie, dass der geplante neue Hamburg-Leuchtturm noch fertig gebaut wird? Noch glaube ich es, weil alle anderen Alternativen für alle Beteiligten am Ende schwieriger sind. Klar, die Investoren versuchen einen Teil ihres Geldes zu retten. Doch die Politik muss erkennen, dass er kein rein privates Bauobjekt ist, sondern auch ein politisch gewolltes Haus. Der Elbtower war die große, letzte Präsentation des Bürgermeisters Olaf Scholz. Und in dem Moment hat sich die Stadt 2017 an das Projekt gebunden. Deswegen muss die Stadt jetzt auch den politischen Mut haben, Wege zu finden, dass das Ding läuft.
Machen sich Senat und Bürgerschaft beim Elbtower einen schlanken Fuß, auch weil der Wahlkampf für die neue Bürgerschaft Anfang 2025 schon begonnen hat und niemand dieses toxische Objekt an der Backe haben will? Von den Parteien aus gesehen verstehe ich die Befürchtung sogar. Und ich finde die Haltung, dass man kein Steuergeld hineinpumpen möchte, nachvollziehbar. Aber nichts tun ist keine wirkliche Alternative. Es gibt immer Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Natürlich ist eine Lösung durch die Insolvenz der Signa Prime Selection und der Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG nicht einfacher geworden, da immer der Insolvenzverwalter mit am Tisch sitzt. Es ist wie mit der heißen Kartoffel, die keiner in die Hand nehmen möchte. Nur das Problem ist: Die Kartoffel ist da, und sie ist für jeden sichtbar. Auch eine Ruine leuchtet. Zu glauben, dass man die aus dem Wahlkampf zur Bürgerschaft heraushalten kann, ist ein frommer Wunsch.
Ist auch Psychologie im Spiel? Fehlt Hamburg etwas großzügiger Bau-Mut? Beim Elbtower eigentlich nicht. Da waren im Jahre 2017 auch nur wenige Bürger dagegen. Man wollte ein wenig am Status der Weltmetropole schnuppern. Da man sich damals dazu entschieden hat, muss man es jetzt weiterführen. Sonst wäre der „Kurze Olaf“ ein Provinzwahrzeichen, ein Turmbau zu Hamburg.
Ziehen Sie bitte doch mal eine städtebauliche und stadtplanerische HafenCity-Bilanz. Was gefällt Ihnen und was nicht? Insgesamt finde ich die HafenCity gut und vergebe eine 2 minus. Wirklich urteilen kann man eigentlich erst in 15, 20 Jahren, wenn sich die HafenCity entwickelt hat und gewachsen ist wie andere Hamburger Stadtteile. Man kann jedoch schon heute feststellen, dass die HafenCity im Osten nicht nur an Tempo, sondern auch an Bauqualität verloren hat – unter anderem durch das nachvollziehbare Ziel, mit hoher Verdichtung viele Wohnungen zu bauen. Ob das dann immer so große Blöcke dicht aufeinander sein müssen, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass zum Beispiel mit dem neuen Digital Art Museum am Ende des Baakenhafens und seinem Entrée zum Amerigo-Vespucci-Platz hin dort im Osten eine neue Qualität entsteht. Wenn man klassisch an der Elbe entlangbummelt, an der Elbphilharmonie startet und über den Kaiserkai mit seinen individuellen Gebäuden über die Magellan-Terrassen und den Grasbrookpark in die östliche HafenCity geht, nimmt meine Begeisterung schon arg ab. Daran kann der sogenannte Grünzug am Kirchenpauerkai auch nicht mehr viel ändern. Ob das Baakenhafen-Quartier zum Flanieren für Touristen einlädt, bezweifle ich. Es wird wahrscheinlich ein etwas toter Bereich bleiben.
Die HafenCity hat einen grünen, nachhaltig orientierten Quartierssound mit zu wenig Grünflächen, unsicheren oder fehlenden Radwegen sowie auch eine automobile Fangemeinde, die über Parkraumvernichtung, zu wenig Stellplätze und Anti-Auto-Stadtteil-Politik unglücklich ist.
Wie sehen Sie das als Beobachter? Na, man hat zu Beginn schon die Radfahrer komplett vergessen und plante nach dem Prinzip der autofixierten Stadt. Denken Sie an die Debatten um das Elbphilharmonie-Parkhaus, wo alle sagten, dass das für die Gäste mit Pkw nie reichen würde. Heute ist es meistens halbleer, und die Besucher kommen mit Bussen, U-Bahn oder zu Fuß zu den Veranstaltungen. Die Stadt und die HafenCity leidet schon darunter, dass man da anders geplant hat. Nun versucht man peu à peu zurückzubauen und umzusteuern, doch es bleibt immer ein wenig Flickschusterei.
Und, hat die HafenCity zu wenig Grün? Da empfehle ich Ihnen den Blick in den Stadtteil Eimsbüttel, wo ich früher wohnte. Hoheluft ist einer der am dichtesten besiedelten Stadtteile Deutschlands und hat abgesehen von einzelnen Bäumen, dem Isebek-Ufer oder dem kleinen Weiher am Mittleren Ring kaum Grün und ist trotzdem einer der beliebtesten Stadtteile Hamburgs, weil er lebendig ist und viel Außengastronomie-Angebote bietet. Außerdem, finde ich, braucht sich niemand in Beton eingesperrt und im Asphalt eingeklemmt fühlen. Wir haben überall Wasser und die Elbe, an der man Weite erleben kann. Im Übrigen hat die HafenCity neben dem grünen Lohsepark funktionierende Plätze, das ist in Hamburg fast ein Alleinstellungsmerkmal. Ob die Magellan- oder Marco-Polo-Terrassen, der Platz der Deutschen Einheit an der Elbphilharmonie oder andere kleine Plätze. Und: Sie werden genutzt. Der Vorwurf des fehlenden Grüns ist nachvollziehbar, er ist auch schick, aber alles in allem nicht berechtigt.
Sie wohnen in den Hamburger Elbvororten. Wie wirkt auf den Othmarscher Bürger der junge Stadtteil HafenCity durch die bürgerlich-grüne Vorstadtbrille? Als Teil der erweiterten Innenstadt und als Ausflugsziel, wenn man Gäste hat: Die wollen immer mal in die HafenCity schauen. Ich habe dort kein Stammlokal, doch wir gehen gerne abends zum Essen oder Draußensein auch in die HafenCity. In Othmarschen sind, klar, die Strandperle und der Elbstrand die Lieblingsorte.
»Der Zweckoptimismus der Innenstadt-Kaufleute ist gut, doch ich fürchte, dass das Überseequartier der City noch einmal deutlich Passanten- und Konsumentenströme abspenstig macht. Und das in einer Situation, in der sich viele Händler in der Innenstadt weitere Rückgänge nicht leisten können.«
Matthias Iken über die Folgen des neuen Westfield Hamburg-Überseequartiers
Mit Eröffnung des Überseequartiers im April sollen Innenstadt und HafenCity stärker zusammenwachsen. Klappt das? Diese Idee ist eine der größten Torheiten. Man hatte rund 20 Jahre Zeit seit Beschluss des Innenstadt-Masterplans, sich darauf vorzubereiten, und zehn Jahre, seit das Überseequartier beschlossen wurde. Man hatte ausreichend Zeit, sich vernünftige Konzepte zu überlegen, wie man die Innenstadt-Quartiere zu Fuß oder mit anderen Verkehren neu und erstmals verbinden kann. Passiert ist nichts. Seit einem halben Jahr gibt es Diskussionen und Werkstattverfahren, deren Ergebnisse wohl erst in Jahren umgesetzt sein werden. Das könnte für manchen in der Innenstadt wie in der HafenCity zu spät sein.
SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf beklagt in der HafenCity Zeitung, dass größere Visionen fehlten und man zu viel Kleinklein plane, zum Beispiel bei der Dom-Achse und der Überquerung der Willy-Brandt-Straße. Stimmt das? Da hat er recht. Aber seine SPD ist seit 2011 an der Macht und hat verpasst, frühzeitig Ideen, Bürger- und Architektenwettbewerbe zu starten. Kienscherfs Gedanke einer begrünten High Line nach New Yorker Vorbild über die Willy-Brandt-Straße klingt spannend, kommt nur arg spät, um daraus für die aktuelle Situation etwas zu entwickeln und zu verbessern.
Die Innenstadt-Kaufleute fordern eine Bus-Ringlinie zwischen City- und HafenCity-Hotspots, und die Verkehrsbehörde prüft die Verlängerung der Metrobuslinie 4 von der Brandstwiete zum Überseequartier. Hilft das? Wer 2024 eine Buslinie für die verbindende Lösung zwischen neuen und alten Innenstadtquartieren hält, glaubt wahrscheinlich noch an den Klapperstorch. Das bringt die City nicht weiter. Bus ist generell eine Krücke. Wer will heute noch unkomfortabel Bus fahren? Das gilt erst recht für Besucher, die von außerhalb kommen. Der Weg muss das Ziel sein. Die Menschen lieben Promenaden. Wir brauchen eine fußläufige Verbindung, an der man entlangschlendern möchte, weil es dort Attraktionen gibt. Das schafft man nur nicht mehr bis zur Eröffnung des Überseequartiers.
Was hilft? Wir müssen die Menschen da abholen, wo sie gerade sind, und dann, wie auch immer, hinübertransferieren. Der Weg müsste das Ziel sein. Die fußläufige Verbindung sollte mit künstlerischen Gestaltungen und Aufenthaltsorten so attraktiv werden, dass ein jeder da entlanggehen will, dass man regelrecht angezogen wird und sich auf diesem Weg über Social-Media-Kanäle inszeniert. Aber wie gesagt, das bekommen wir nicht von heute auf morgen hin.
Zum Schluss noch eine Branchenfrage. Die Tageszeitung »Hamburger Morgenpost« erscheint ab April nur noch wöchentlich wegen sinkender Zeitungsnachfrage, und auch das »Hamburger Abendblatt« hat wie alle großen Regionalzeitungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten dramatisch an Auflage verloren. Ihre Abonnenten werden heute mit 10 bis 15 Push-Meldungen via abendblatt.de versorgt. Hat der klassische Zeitungsjournalismus seine romantische Relevanz verloren? „Romantische Relevanz“ ist schön. Ich bin Journalist und nicht Zeitungsjournalist. Der Ausspielkanal ist nicht entscheidend. Journalismus wird weiter gebraucht werden. Einige Leser werden ihn weiter auf Papier haben wollen, weil wir den Menschen das Wichtigste vom Tage ausdrucken und nach Hause liefern, die Zeitung ist kuratiert, der Leser bekommt Einordnung. Andere wollen durch mobile Geräte sofort und überall informiert sein, andere schätzen die E-Paper-Zeitung oder Podcasts. Wer heute nur Zeitung macht, ist tot.
Warum wirken Sie bei Ihren Aussagen nicht vollumfänglich glücklich? Weil wir als Gesellschaft nicht unbedingt gewinnen, wenn alles schneller wird. Ein Beispiel: Irgendwo wird ein herrenloser Koffer gefunden, etwa am Bahnhof. Großalarm auf allen Kanälen: Der Bahnhof wird aus Sicherheitsgründen dichtgemacht, es laufen Eilmeldungen, ständig kommen Push-Nachrichten. Wenn dann in dem Koffer nur Wäsche war, die jemand vergessen hat, wäre diese „News“ früher am nächsten Tag in der Zeitung zur Vierzeilen-Meldung geschrumpft. Online aber bindet sie unfassbar viele Kapazitäten der Redaktion, die es am Ende nicht wert sind, und die ganze Stadt wird nervös. Wir sind immer öfter permanent aufgeregt, weil wir die Welt inzwischen durch eine Fußball-Ticker-Brille sehen, in der minütlich Spielgeschehen und Spielstand rausgehauen werden. Wir tickern heute die ganze Weltlage, verpassen die Hintergründe und werden oberflächlich. Das ist nicht gut für die Nutzer, für unseren Job. Und für die Demokratie auch nicht.
Die berühmte Klick- und Reichweiten-Sucht im digitalen Journalismus: Wie ändern wir das? Das ist die Eine-Million-Euro-Frage (lacht). Im Ernst. Ich halte diese Entwicklung für gefährlich. Das Gespräch führte Wolfgang Timpe