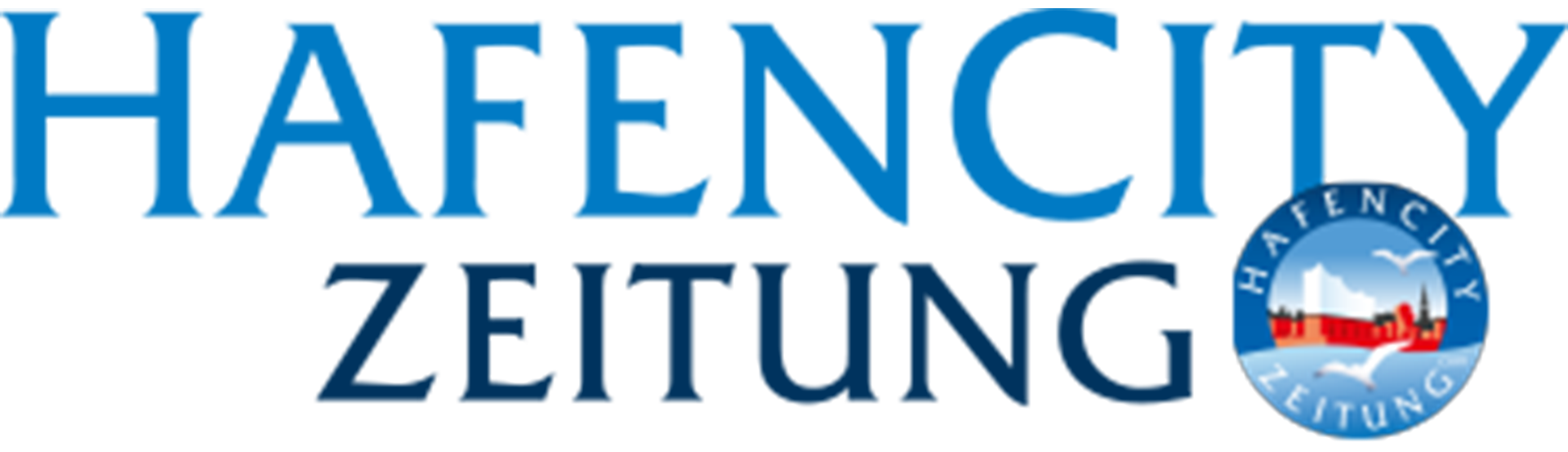Verlosung. Der Schauspieler Götz Otto spielt in »Die Carmen von St. Pauli« im St. Pauli Theater wieder mal einen Bösewicht. Dagmar Leischow traf ihn
Vor der nächsten „Die Carmen von St. Pauli“-Probe im St. Pauli Theater nimmt sich der Schauspieler Götz Otto Zeit für ein Interview. Er sitzt in einem Raum in der oberen Etage des Hauses. Hinter ihm hängt ein großes Foto seines Kollegen Ulrich Tukur, der in Peter Jordans Inszenierung jedoch nicht mitspielt. Götz Otto verkörpert in dieser Aufführung einen Bösewicht – wie so oft. Dabei ist er abseits des Rampenlichts total sympathisch, höflich und sehr umgänglich.
Foto oben: Götz Otto: „Ich schätze an St. Pauli die Ehrlichkeit. Ich treibe mich hier gern herum, weil ich sehen will, wie das Nacht- und Tagleben funktioniert. Ebenso spannend finde ich es zu beobachten, wie sich St. Pauli verändert hat.
„Carmen“ ist eigentlich eine Oper von Georges Bizet. Sind Sie Opernfan? Ganz ehrlich: nein! Ich fand Oper immer trutschig und plüschig. Aber wir machen ja eine richtige Show, in die sowohl Elemente aus der Oper als auch Elemente aus dem Stummfilm „Die Carmen von St. Pauli“ von 1928 einfließen. Wir singen alle Arien, zum Beispiel „Habanera“. Teilweise allerdings mit anderen Texten, weil das Stück im Hamburger Hafen und im Rotlichtmilieu angesiedelt ist.
Sind Sie wieder einmal der Bösewicht? Ja. Ich bin ein böser Pfeffersack – gefährlich und ein bisschen verrückt. Mein Charakter verliert am Schluss den Bezug zur Realität.
Reizen Sie als Schauspieler die Bösen mehr als Helden? Wenn eine Figur gut ausgearbeitet ist, tut es nichts zur Sache, ob sie positiv oder negativ konnotiert ist. Gleichwohl haben die Guten selten Fallhöhe, sie haben kein wirkliches Problem. Deshalb ist es manchmal langweilig, sie zu spielen.

Stimmt es, dass Sie im Laufe Ihrer Karriere zu 80 Prozent Nazis verkörpert haben? Zumindest gab es eine Zeit, in der ich sehr viele Nazis gespielt habe. Das Positive daran war: Ich hatte Arbeit. Gerade im Ausland sind Deutsche gefragt, wenn eine Produktion im Dritten Reich spielt. Mit ihnen werden meistens die Nazirollen besetzt.
Immerhin brachte Ihnen das schon als Schauspielschüler einen Part in „Schindlers Liste“ ein. Als ich ans Set kam, habe ich gegrübelt: Wer ist denn jetzt Steven Spielberg? Damals konnte man nämlich nicht mal eben googeln, wie jemand aussieht. Das waren völlig andere Zeiten. Auf jeden Fall war ich eine Art gehobener Statist. Ich musste dauernd irgendwo einspringen. Das war großartig! Als ich nach Deutschland zurückgekehrt bin, war ich noch ein halbes Jahr voll auf körpereigenen Drogen.
Am populärsten hat Sie Ihre Rolle als Bond-Gegenspieler Stamper in „Der Morgen stirbt nie“ gemacht. Wie waren die Dreharbeiten in Hamburg? Toll! Auf der einen Seite war das eine aufwendige internationale Großproduktion, andererseits hatte ich eine Verbindung zu meiner deutschen Heimat. Ich habe damals die Kneipe Zwick komplett gemietet und dort eine legendäre Produktionsparty gefeiert. Ob Pierce Brosnan oder Jonathan Pryce: Alle waren da. Lediglich Michelle Yeoh fehlte, weil sie nicht in Hamburg gedreht hat.
Wurden Sie nach dem Bond-Streifen mit Rollenangeboten überschüttet? Ich habe zwar ein paar kleine, schöne internationale Filme gedreht, nur hat sie kaum jemand gesehen. Einmal der Bond-Bösewicht gewesen zu sein, bedeutet nicht, dass man es geschafft hat. Ich sage immer: „Ich habe Karriere gemacht, wenn meine Familie und ich bis an mein Lebensende von meinem Beruf leben können.“ Als Schauspieler weiß man nie, wie es morgen weitergeht. Man steckt ständig in einer ungewissen Situation.
Sie haben kürzlich im Winterhuder Fährhaus auf der Bühne gestanden, nun sind Sie am St. Pauli Theater engagiert. Ist das Zufall, oder lieben Sie Hamburg einfach? Auch wenn sich die Engagements zufällig ergeben haben: Ich mag Hamburg sehr. Als großer Freund des Stand-up-Paddling genieße ich es, die Stadt vom Wasser aus zu erleben. Ich hatte lange eine Theaterwohnung in Eppendorf. Als ich diesmal wieder in diese Gegend ziehen sollte, habe ich das aber abgelehnt. Für „Die Carmen von St. Pauli“ wollte ich unbedingt auf dem Kiez wohnen.
Was schätzen Sie an St. Pauli besonders? Die Ehrlichkeit. Ich treibe mich hier gern herum, weil ich sehen will, wie das Nacht- und Tagleben funktioniert. Ebenso spannend finde ich es zu beobachten, wie sich St. Pauli verändert hat. In dem Film „Die Carmen von St. Pauli“ war dieser Stadtteil noch sehr eng mit dem Hafen verbunden – auch sozial. Mittlerweile gibt es zwischen St. Pauli und dem Hafen eigentlich nur noch ein reines Arbeitsverhältnis. Interview: Dagmar Leischow
Info „Die Carmen von St. Pauli“ läuft am 1. Dezember sowie vom 8. bis 19. Januar im St. Pauli Theater. Karten und weitere Informationen unter www.st-pauli-theater.de