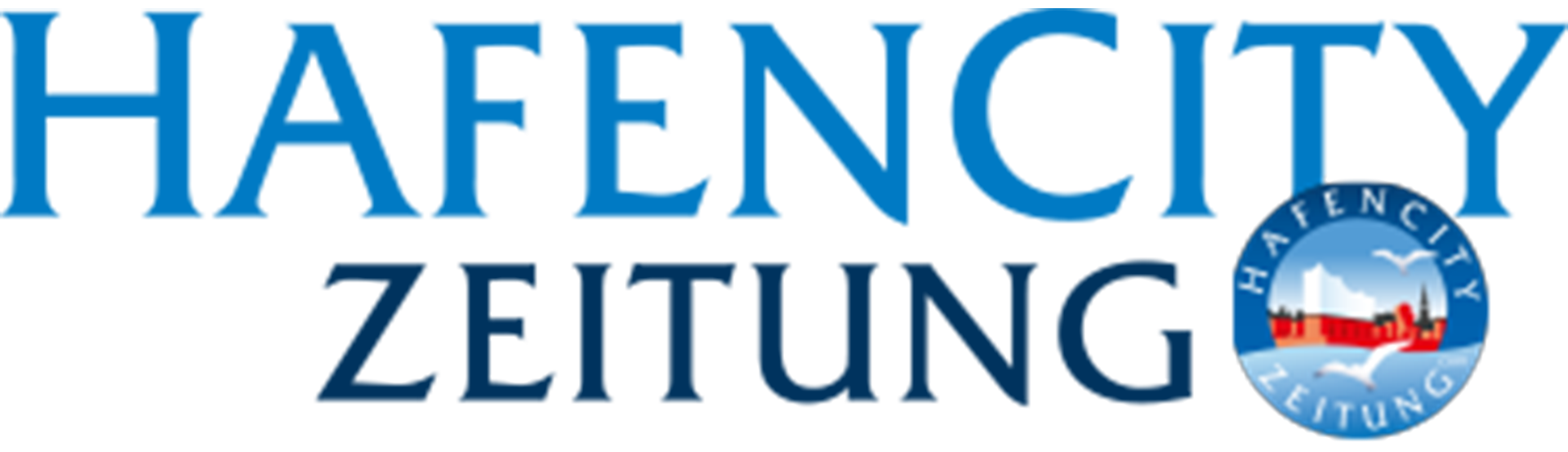HCZ-Gastautor Falko Droßmann, Bezirkschef von Hamburg-Mitte, folgt dem Rat von „Alice im Wunderland“
Am 24.Dezember sprach die Pastorin meiner Kirchengemeinde davon, dass es gut sei, wenn man sich in der Weihnachtszeit einmal „neben sich selbst stellen möge“, um eine andere Perspektive auf das eigene Leben zu bekommen. Leichter gesagt, als getan, besteht doch das Weihnachtsfest bei Vielen, so auch bei mir, aus einer Abfolge familiärer Verpflichtungen, bei der nicht zuletzt ein genealogischer Almanach hilfreich wäre, um wirklich jede anwesende Großcousine richtig einordnen zu können. Nichts desto trotz hat es mir die aus der Menge der aufgetragenen Festspeisen resultierende Maximalentschleunigung (vulgo: Fressnarkose) ermöglicht, den Rat der Pastorin einmal umzusetzen.
Foto oben: Bezirkschef Falko Droßmann lehnt aktuell wegen zu hoher Kosten die Übernahme der Grünflächen der HafenCity ab: „Nur ein fehlender Unterhalt von Grünanlagen ist sichtbar, nur eine fehlende soziale Infrastruktur ist messbar.“ © Thomas Hampel
Im Bezirk Hamburg-Mitte leben beinahe 300.000 Menschen. Nicht der größte Bezirk (das ist Bergedorf) oder der mit den meisten Menschen (das ist Wandsbek), aber doch unstrittig der bunteste, quirligste und vielfältigste Teil unserer Stadt. Schon im alltäglichen Leben sind die Unterschiede zwischen St. Pauli und der Veddel, Finkenwerder und Billstedt oder Wilhelmsburg und der HafenCity weniger von Feinheiten als von großen Unterschieden geprägt.

Mir ist es immer ein Anliegen, so häufig wie möglich neben meiner Verantwortung für knapp 1700 Mitarbeitende oder auch der Teilnahme an Sitzungen in Behörden oder im Rathaus an den mehrfach in der Woche stattfindenden Sitzungen der Sanierungsbeiräte, Stadtteilkonferenzen, Quartiersforen, Stadtteilbeiräte (es gibt hiervon im Bezirk ca. 20) teilzunehmen. Wichtig ist meine Teilnahme, da diese Sitzungen der Koordination, der Absprache, dem Entscheiden, dem Erklären und dem gemeinsamen Vorgehen in unserer Stadt gelten.
Falko Droßmann
ist seit 25. Februar 2016 Leiter des Bezirks Hamburg-Mitte,
zu dem 19 Stadtteile gehören – u.a. auch die HafenCity und ihre Nachbarstadtteile
wie St. Pauli, Alt- und Neustadt, City, St. Georg, Hammerbrook, Rothenburgsort, die Veddel oder Wilhelmsburg. Der 46-Jährige lebt in der HafenCity.

Nun ist es naturgemäß so, dass der absolute Großteil dieser Treffen kurzweilig und spannend ist und oft ein großer Genuss ist.
In sehr seltenen Fällen aber sitze ich in Runden, deren Sinn und Zweck sich mir nicht immer erschließt. Mitunter werden von wenigen einzelnen Personen, die aber immer den Anspruch haben, (allein) für ihren Stadtteil zu sprechen, die immer selben Argumente in der epischen Breite eines russischen Romans des 19. Jahrhundert vorgetragen. Interessant an diesen Personen ist, dass sie gleich in mehreren Beiräten auftauchen. So verschwimmen die willkürlichen Grenzen zwischen unseren Stadtteilen und ich bin fasziniert, wie eloquent sich diese (immer noch einzelnen) Menschen wahlweise als „wir St.Georger“, „wir Innenstädter“, „wir St.Paulianer“, „wir in der HafenCity“ durch mein berufliches Leben pluralisieren.
Die selbsternannten Volkstribune der Stadtteile erinnern mich an „Grinsekatze“ oder „Faselhasen“.
Als ich nun Weihnachten so darüber nachdachte, wie es eigentlich gelingen könnte, neben diesen zeitfressenden Morlocks – die im Übrigen oft hauptberuflich Bürgerbeteiligung machen – noch mehr mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die nicht die Muße oder Möglichkeit haben, an den (Stadtteilbei-, Quartiersbei-, Sanierungsbei-) Ratssitungen teilzunehmen, fiel mein Blick auf die Kinder- und Jugendbücher, die noch immer im Regal in der Ecke unseres ehemaligen Kinderzimmers stehen.
Ein wenig gedankenverloren nahm ich ein Buch heraus, welches ich vor einigen Jahrzehnten gelesen hatte. Es war das Werk des englischen Autors Lewis Carrol, der 1865 sein Werk „Alice im Wunderland“ veröffentlichte.
Es mag ein wenig unfair gewesen sein, aber ich ging im Geiste die selbsternannten Volkstribune der verschiedenen Stadtteile durch und erinnerte mich an die Figuren, denen Alice im Wunderland begegnet ist: Die Grinsekatze. Den weißen Hasen. Den Herzbuben. Den Schildkrötensupperich. Den Frosch-Lakai. Ich erinnerte mich an Bill die Eidechse, Dodo und nicht zuletzt an den Faselhasen.
Neben den Charakteren las ich mich aber auch an einige Zitate, die Lewis Caroll seinen Figuren mitgab. Ein wesentlicher für mich war die Szene, als Alice (die im Wunderland) die Katze fragte, wie es nun weitergehen solle. Die erschütternde Antwort der Katze war „Das hängt vom großen Teil davon ab, wohin Du möchtest“.
In diesem kurzen Satz liegt der Kern politischer Auseinandersetzung, Ursache jeder Diskussion und Anlass jeden (auch des konstruktiven) Streits. So unterschiedlich sind die Meinungen, das eigene Erleben, die eigenen Moralvorstellungen und Lebensentwürfe, dass die Definition des Ziels heutzutage zu den schwierigsten Herausforderungen geworden ist.
Ich versetze mich in unterschiedlichen Quartieren in unterschiedliche Lebenswirklichkeiten.
Für die eine mag es, bezogen auf meine Tätigkeit, die Anzahl der Bäume in einem Stadtteil sein. Für die andere die Möglichkeit, alle Familienautos bitte kostenlos auf öffentlichen (also Gemeinschafts-) Flächen abstellen zu können (dafür zahle sie ja schließlich Steuern). Für den nächsten ist die Anerkennung besonderer Umstände bei der Berechnung der Sozialhilfe das wichtigste Ziel, für den anderen, eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist, auch ohne einen akademischen Abschluss haben und mehr 40.000 Euro im Jahr verdienen zu können.
So vielfältig die Menschen, so unterschiedlich ihre Lebenswirklichkeit. Für mich ist spannend, mich in unterschiedlichen Quartieren in die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten der Menschen zu versetzen. Hierbei beobachte ich, wie sehr auch in unserer Stadt das gesellschaftliche Sein noch immer das Bewusstsein bestimmt.
Aber auch die Art der Auseinandersetzung. So habe ich durch Dutzende Gespräche, Runden, Diskussionen in Horn (mit knapp 40.000 Einwohnern immerhin so groß wie Pinneberg oder Buxtehude) einen Prozess miterlebt, der zu einer Zäsur im Stadtteil führen kann. In beeindruckend konstruktiver Diskussion wurde über Jugendeinrichtungen, Seniorentreffs, Kinderspielplätze diskutiert, wurden öffentliche Ressourcen verhandelt und neue Modelle der Beteiligung und Entscheidung ausprobiert. Beeindruckend, weil jeder und jede die Bedürfnisse des und der anderen akzeptierte. Dies nicht nur für die individuellen Bedürfnisse, sondern auch die der Verwaltung, der Politik, der Unternehmen, der Gemeinwohlverbände, der Religionsgemeinschaften, der Migrantischen Organisationen, der Kultur.
Natürlich habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie das in „meinem Stadtteil“ denn einmal werden könnte. „Meine HafenCity“ hat neben architektonischen Highlights die Besonderheit, dass sie gerade erst zu einem „normalen“ Stadtteil wird. Sicher hat die HafenCity noch immer die Besonderheit, über schwindelerregende Durchschnittseinkommen der meist deutschen, im Gegensatz zu anderen Stadtteilen eher lebenserfahreneren Bevölkerung zu verfügen.
Darüber hinaus lernt die HafenCity gerade erst, dass Beteiligung nicht ausschließlich funktionieren muss wie in Monty Pythons Klamauk-Klassiker „Das Leben des Brian“, in dem die judäische Volksfront gegen die Volksfront von Judäa kämpft, zwei gleichklingende Namen, deren Vertreter sich vehement streiten. Noch ist es ja so. Bei dem Streit um das Überseequartier, in dem die eine Architekteninitiative (Wir sind die HafenCity und haben da auch schon gebaut!) gegen andere Architekten („Wir wollen kosmopolitisch präsentieren, aufgeschlossen und facettenreich!“ – und auch bauen!) wettern. Natürlich mit Unterstützung von namhaften Kanzleien vor ehrenwerten Verwaltungsgerichten.
Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Auch diese Auseinandersetzung ist legitim. Sie geht aber an der Mehrheit der Menschen vorbei.
Es ist hierbei nicht so, dass ich es besser machte. Nehmen wir nur einmal das Beispiel den Unterhalt öffentlicher Anlagen. Was so knöchern klingt, beschäftigt mich seit Jahren intensiv: In der HafenCity konnten sich namhafte Architekten lange Zeit auch im öffentlichen Raum austoben. Die besten, hamburgweit bekannten Spielplätze, bei denen es überall plätschert, sich herrlich rutscht und noch schöner buddelt. Bis zum Übergang der östlichen Teile der HafenCity wurden seitens des Entwicklers mehr als 15 Mal so viel Geld für die Unterhaltung der Spielplätze und Grünanlagen ausgegeben, als es der Bezirk überhaupt könnte. Die Folgen und sich daraus ergebenden Fragestellungen sind nicht profan: Da die Umweltbehörde (die in Hamburg für die Verteilung der Gelder für Grünanlagen zuständig ist) einen Sonderbedarf der HafenCity nicht anerkennt, bleibt dem Bezirksamt nur die Wahl, entweder Anlagen stillzulegen oder Gelder aus zum Beispiel Billstedt oder Wilhelmsburg abzuziehen, um den gebauten Standard in der HafenCity aufrecht zu erhalten. Und daraus ergibt sich die Frage, ob wir seitens der demokratisch verfassten Stadt eigentlich ein Quartier haben wollen, in dem zwar deutlich weniger Menschen leben, aber die öffentlichen Ausgaben ein Vielfaches anderer Stadtteile sind. Wird sich etwa der Übergang der HafenCity in einen normalen Stadtteil am Zustand der öffentlichen Grünanlagen und Wege ablesen lassen – im schlechtesten Sinne?
Ein weiteres: Der Bezirk Hamburg-Mitte betreibt neun Einrichtungen der Familienförderung, 50 Kinder- und Jugendeinrichtungen, 14 Einrichtungen der Stadtteilkultur, 53 Projekte der Stadtteilkultur, 51 Quartierbezogene Projekte und 16 Integrationsprojekte. In der HafenCity sind keine Räume für solche Einrichtungen vorgesehen. Egal, ob eine solche Einrichtung nun „Haus der Jugend“ oder in HafenCity-Deutsch „Maker-Hub“ heißt: sie fehlt. Beide Beispiele –und ich könnte noch viele in dieser Art beschreiben – haben die Eigenart, dass wir ihre Wirkung nur sehen, wenn sie nicht stattfinden. Nur ein fehlender Unterhalt von Grünanlagen ist sichtbar, nur eine fehlende soziale Infrastruktur ist messbar.
Ich würde mir wünschen, dass wir diese Diskussion gemeinsam in die Öffentlichkeit tragen und diese Fragestellungen gemeinsam in unserer Stadt diskutieren. Vielleicht sogar nicht über die einschlägigen Hamburger Leit(empörungs)medien oder über gegenseitige Vorwürfe (in denen wir alle sehr gut sind!), sondern über gute Diskussionsprozesse und gemeinsame Entscheidungen.
In der letzten meiner zweiwöchentlichen Bürgerinnen- und Bürgersprechstunden hatte ich ein wunderbares Erlebnis, welches die Situation in der HafenCity gut beschreibt. Zuerst kam eine Hausgemeinschaft zu mir (natürlich mit Rechtsbeistand), die sich über die Lichtverschmutzung vor ihrem Haus beklagte. Nur mit „viel Geld“ für Vorhänge und Jalousie sei möglich, das „grelle Neonlicht“ der „übertriebenen Straßenlaternen“ am Kai („total überflüssig“) aus den Wohnungen zu halten. Ich solle endlich etwas dagegen tun. In derselben Sprechstunde stellte sich eine Initiative (übrigens in Begleitung eines Anwaltes aus derselben Kanzlei) vor, die vom „schwarzen Loch“ HafenCity sprach, die von dunklen Angsträumen beherrscht sei und forderte mich auf, endlich meiner (Verkehrssicherungs-) Pflicht nachzukommen und mehr Straßenlaternen auch auf den Gehwegen und Kaianlagen zu errichten.
Ich habe bereits an anderer Stelle in dieser Zeitung gesagt, dass die HafenCity für mich der spannendste und heraufordernste Stadtteil ist. Denn hier müssen wir uns als städtische Gemeinschaft und Gemeinschaft im Stadtteil noch unserer gemeinsamen Ziele bewusst werden. Denn auch die HafenCity wird unterschiedlicher, bunter, vielfältiger werden, als wir und das heute vielleicht vorstellen können.
Und so verbleibe ich, nun nicht mehr neben mir stehend, mit dem verrückten Hutmacher aus Alice im Wunderland: „Das Unmögliche zu schaffen gelingt einem nur, wenn man es für möglich befindet.“ Falko Droßmann