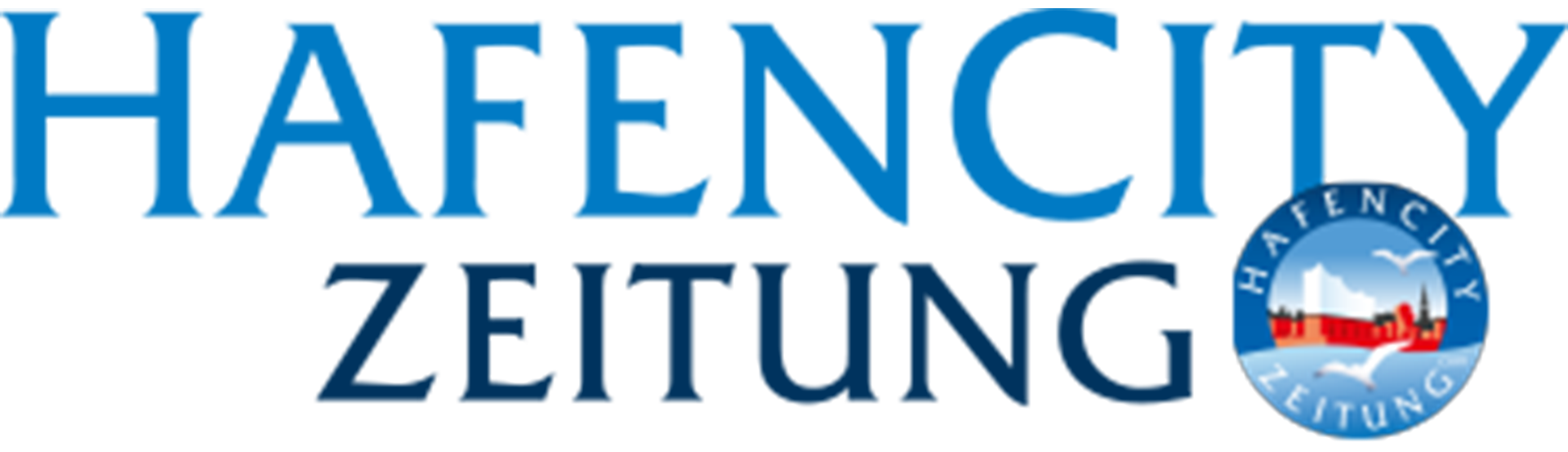Gunther Bonz, Mr. Hafenwirtschaft und Eurogate-Chef,
über Corona, Kosten und grüne Bremser im Gespräch mit Wolfgang Time und Melanie Wagner.
Das gesamte Interview gibt es als Audio-Version im Podcast Redefluss
Herr Bonz, wo und wie haben Sie eigentlich als ausgebildeter Verwaltungsjurist das Netzwerken in der Wirtschaft gelernt?
In der Familie. Ich bin in einer schifffahrtsaffinen Familie groß geworden. Mein Vater war Arzt und meine Mutter stammte aus einer Bremer Kaufmannsfamilie. Aber mein Onkel, der wie ein zweiter Vater für mich war, war Schifffahrtskaufmann und viele Jahre Aufsichtsratsvorsitzender der großen chilenischen Schifffahrtsfirma Ultramar, gegründet von einem ehemaligen Hapag-Lloyd-Kapitän aus Hamburg, und davor Vorstandsvorsitzender einer großen Schifffahrtsagentur in Emden. Über diese Netzwerke meines Onkels bin ich eigentlich seit meinem 14. Lebensjahr in den Schifffahrtsbereich hineingewachsen. Die Affinität zur Schifffahrt ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Und da ich kein Blut sehen kann, kam für mich die Profession meines Vaters nicht in Betracht. Auf dem heutigen Terminalgelände von Eurogate in Waltershof, also dort, wo ich arbeite, war in meiner Kindheit ein Schwimmbad, in dem ich schwimmen gelernt habe. Insofern schließen sich auch Kreise – von meiner Kindheit zum Erwachsenwerden.
Und was, um Himmels Willen, macht eigentlich ein Generalbevollmächtigter im Gegensatz zu einem schnöden Geschäftsführer eines Unternehmens?
Ich bin ja auch Geschäftsführer für den Eurogate-Terminal, Generalbevollmächtigter bin ich für die Gesamtgruppe. Mir obliegen übergeordnete Themen wie etwa Fragen der Gesetzgebung oder hafenpolitische Fragestellungen. Das betrifft auch meine Aufgabe als Präsident der Feport in Brüssel, dem Zusammenschluss aller privaten europäischen Terminalbetreiber, der ich ja auch noch bin. Und da die Hafenwirtschaft stark von der EU-Kommission und vom EU-Parlament geprägt und beeinflusst wird, muss ich mich mit vielen Gesetzgebungsfragen beschäftigen. Zum Beispiel hat die EU-Kommission Vorschläge gemacht, wie der maritimen Branche in der Corona-Krise geholfen werden kann. Sie hatte aber die Terminalbetreiber vergessen. Ich habe dann mit meinen Kollegen dafür gesorgt, dass die Flächenmieten in den Häfen für einen befristeten Zeitraum gesenkt werden können, ohne dass man ein kompliziertes Bewilligungsverfahren durchlaufen muss. Das war ein wichtiger Schritt, um die Krise bewältigen zu können.
Sie sind also im besten Sinne Lobbyist?
Ich würde mich nicht als Lobbyist bezeichnen. Ein Lobbyist vertritt Unternehmens- und Wirtschaftsinteressen, und wenn es sein muss, auch gegen seine persönliche Überzeugung, weil er dafür bezahlt wird. Das ist bei mir anders. Sowohl die Präsidentschaft für den Unternehmensverband Hafen Hamburg (UVHH) als auch für Feport ist ehrenamtlich. Deshalb verstehe ich mich eher als Interessenvertreter, der sachkundige Informationen liefert, die als Grundlage für wirtschaftspolitische Entscheidungen dienen.

Gunther Bonz ist Verwaltungsjurist und Hafenmanager. Der 64-Jährige, ein gebürtiger Hamburger, war von 2004 bis 2008 Hamburger Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde und ist seit 2009 Generalbevollmächtigter von Eurogate, Europas größter reedereiunabhängiger Container-Terminal- und Logistikgruppe. Ferner of European Private Port Operators) in Brüssel und seit 2011 Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg. Nach seinem Abitur am Matthias-Claudius-Gymnasium in Hamburg studierte Bonz an der dortigen Universität Rechtswissenschaften. Nach seinem 2. Staatsexamen trat er 1983 als Beamter in den Hamburger Staatsdienst ein und ging bereits ein Jahr später im Verwaltungsaustausch für ein Jahr in die Rechts- und Stadtplanungsabteilung in Fort Collins/Colorado, USA. Von 1990 bis 1998 war er Lehrbeauftragter an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. 1999 wurde er Leiter des Amtes für Wirtschaft und Landwirtschaft in der Hamburger Wirtschaftsbehörde und Senatsdirektor. 2004 berief Bürgermeister Ole von Beust den parteilosen Bonz zum Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde bei Senator Gunnar Uldall. Nach der Bürgerschaftswahl 2008 blieb er auch im neuen schwarz-grünen Senat Staatsrat unter dem Wirtschaftssenator Axel Gedaschko. Bonz ist verheiratet und hat zwei Kinder und drei Enkel.
Seit der Corona-Pandemie gibt es die neuen Abstandsregeln und kein Händeschütteln mehr. Wie hat das Ihre Arbeit verändert?
Das Gute an der Corona-Krise ist, dass wir den persönlichen Kontakt vermissen. Dahinter steckt viel mehr. Natürlich kann man mit Videokonferenzen und Telkos, wie es Neudeutsch heißt, viel Routinearbeit erledigen. Aber die Möglichkeit, sein Gegenüber in seiner gesamten ein Menschlichkeit zu erleben und einschätzen zu können, gibt es nur im persönlichen Zusammentreffen. Auch persönliches Vertrauen kann sich nur im persönlichen Kontakt entwickeln. Und das ist enorm wichtig, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Hafenkollegen in Brüssel zusammenkomme, die allesamt auch Konkurrenten sind. Wir alle haben durch die Corona-Krise gelernt, dass der persönliche Kontakt unabdingbar ist, aber auch, dass wir Routinearbeit, für die wir bisher viel herumgereist sind, effizienter wahrnehmen können. Das ist die Polarität der Corona-Krise.
Wie wichtig ist Psychologie neben alle Daten und Fakten?
Sehr wichtig. Ich behaupte sogar, dass mindestens 50 Prozent von unternehmerischen Entscheidungen nicht auf Zahlen, Daten und Fakten basieren, sondern Herz-, Bauch- und Gefühlsentscheidungen sind. Wenn es anders wäre, könnte jeder mit den entsprechenden Excel-Tabellen ein guter Unternehmer sein.
Mitte April, mitten in Corona-Zeiten, haben Sie gesagt, Sie rechnen mit einem massiven Einbruch für den Hamburger Hafen, weil große Reeder-Allianzen für April und Mai viele Schiffsanläufe, so genannte Dienste, gestrichen haben. Hat sich Ihre düstere Prognose bestätigt?
Ja, aber im eigenen Land gilt der Prophet ja nichts. Ich habe der Hamburger Politik und der Hafenverwaltung HPA ziemlich früh gesagt, was auf uns zukommt. Das wurde negiert. Erst jüngst hat die HPA dann eingestehen müssen, dass der Hamburger Hafen stärker von der Corona-Krise betroffen ist als seine Wettbewerbshäfen. Und ich kann Ihnen sagen, dass es in den nächsten Monaten ein ständiges Auf und Ab mit leicht negativer Tendenz beim Containerumschlag geben wird. Diese Zahlen werden schlechter ausfallen als in unseren Konkurrenzhäfen insbesondere in Rotterdam und Antwerpen, gegen die der Hamburger Hafen in den vergangenen acht Jahren 20 Prozent Marktanteil verloren hat. Das lässt sich einfach erklären.
Und wie?
Es sind drei große Wettbewerbsnachteile, auf die ich die Hamburger Entscheider seit Jahren hingewiesen habe und die durch Corona nur verstärkt, nicht verursacht wurden. In diesem Zusammenhang werfe ich der Hafenverwaltung HPA vor, dass sie ihr eigenes Interesse vor das Gesamtinteresse des Hamburger Hafens stellt.
Die drei Gründe?
Die drei Gründe sind: Erstens die Einfuhrumsatzsteuer. Anders als etwa in Holland und Belgien wird die Einfuhrumsatzsteuer in deutschen Häfen fällig, sobald die Ware die Kaikante erreicht hat. In Holland und Belgien, also Rotterdam und Antwerpen, muss die Einfuhrumsatzsteuer erst vom Endkunden bezahlt werden, also erst, wenn die Ware im Container ihr endgültiges Ziel erreicht hat. Der Spediteur muss nicht im Voraus entrichten. Bei einem Importvolumen von 500 Milliarden Euro pro Jahr und einer Einfuhrumsatzsteuer von drei Prozent, sind das Hunderte von Millionen Euro, die ein Spediteur in deutschen Häfen im Voraus an den Zoll entrichten muss. Ich kenne einige Speditionen, die nur aus diesem Grund keine Importe mehr über den Hamburger Hafen abwickeln. Das Problem ist so gravierend, dass selbst die Bundesregierung diese Regelung ändern will, zumal das der europäische Rahmen auch zulässt. Passiert ist bisher aber nichts.
Die Stärke des Hamburger Hafens, ist die Lage tief im Binnenland. Mit einem Schiff und einer Besatzung von zwölf Mann können Sie heute 20.000 Container über hundert Kilometer tief ins Hinterland bringen. Dafür brauchen sie sonst 20.000 Lkw-Fahrer.“
Und der zweite und dritte Wettbewerbsnachteil für den Hamburger Hafen?
Zweitens: Der Hamburger Hafen hat die mit Abstand höchsten Flächen- und Kaimauermieten in ganz Europa. Gegenüber Rotterdam und Antwerpen sind sie teilweise mehr als doppelt so hoch, was für einen mittleren Hafenbetrieb Mehrkosten zwischen 5 und 8 Millionen Euro pro Jahr bedeutet. Diese Zusatzkosten müssen die Betriebe dann natürlich an ihre Kunden, die Reeder und Spediteure, in Rechnung stellen, die dann lieber in Antwerpen oder Rottedam ihre Ware umschlagen. Der dritte Grund ist die verzögerte Fahrrinnenanpassung.
Warum sind die Mieten im Hafen denn so hoch?
Es gab unter der schwarz-grünen Regierung eine strategische Fehlentscheidung, die die Hafenverwaltung HPA mitgetragen hat, nämlich das tödliche Konzept: Hafen finanziert Hafen. Das bedeutet, dass die gesamten Kosten des Hafenbetriebs über Mieten und Pachten refinanziert werden müssen. Das gibt es in keinem anderen Hafen der Welt! Dazu gehören auch die öffentlichen Straßen, zum Beispiel die Köhlbrandbrücke. Das bedeutet, eine Straße, über die viele Millionen Menschen aus aller Welt und aus Stade und Buxtehude fahren, soll finanziert werden über die Mieten und Pachten im Hafen. Das Konzept ist töricht, dumm und irrsinnig. Es sind also drei Gründe: Einfuhrumsatzsteuer, zu hohe Hafenlasten, verzögerte Fahrrinnenanpassung. Das hält auf Dauer kein Hafen aus.
Aber ganz so schlecht, wie Sie jetzt das Bild malen, kann es doch nicht sein. Welche Stärken hat der Hamburger Hafen?
Natürlich gibt es auch Gutes. Aber der Feind des Positiven ist das Bessere. Wir haben gewisse Vorzüge, aber wir schöpfen unsere Vorteile nicht aus – aus den eben genannten Gründen. Unsere Stärke ist die Lage des Hamburger Hafens, tief im Binnenland. Durch diese Lage können Spediteure ihre Ware auf dem kostengünstigsten Weg, nämlich auf dem Schiff, hunderte Kilometer weit ins Binnenland transportieren. Mit einem Schiff und einer Besatzung von zwölf Mann können Sie heute 20.000 Container über hundert Kilometer tief ins Hinterland bringen. Dafür brauchen sie sonst 20.000 Lkw-Fahrer. Hamburg hat einen der letzten großen Häfen, die weit im Hinterland liegen und für große Schiffe erreichbar sind. Das ist ein riesiger strategischer Vorteil. Darüber hinaus haben wir die beste Hinterland-Anbindung auf Gleisen in ganz Europa.
»Herrn Vöpel vom Weltwirtschaftsinstitut nehme ich nicht ernst. Was er jetzt für einen Hafenbericht im Auftrag des BUND erstellt hat, ist für mich keine wissenschaftliche Studie, sondern ein schlecht gemachtes Parteigutachten.«
Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI), hat in einer für den BUND erstellten Studie festgestellt, dass sich das Geschäftsmodell des Hamburger Hafens überlebt habe. Nicht Containerumschlag sei das Maß der Dinge, sondern der Hafen müsse sich stärker um Zukunftsperspektiven wie Digitalisierung und die Ansiedlung von 3D-Firmen kümmern. Hat er recht?
Herr Vöpel hat keine Ahnung. Er ist kein Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler ist jemand, der Wissen schafft, der sich zumindest schlau macht, bevor er etwas sagt. Hätte er das getan, wüsste er, dass wir im Hamburger Hafen seit vielen Jahren mit Dakosy über ein einzigartiges Datenkommunikationssystem für den Containerumschlag verfügen, das uns erhebliche Wettbewerbsvorteile bringt. Gleiches gilt für das Schiffssteuerungssystem HVCC, das Hamburg Vessel Coordination Center. Wir sind digital schon voll auf dem Wege. Herrn Vöpel nehme ich nicht ernst. Was er jetzt für einen Hafenbericht im Auftrag des BUND erstellt hat, ist für mich keine wissenschaftliche Studie, sondern ein schlecht gemachtes Parteigutachten.
Einigung gibt es aktuell bei den Rot-Grünen Regierungsverhandlungen u.a. darüber, dass der Hafen bis 2040 klimaneutral werden soll. Ist das ein realistisches Ziel?
Wenn man ehrlich ist, ist das nicht möglich. Dabei ist nicht der Containerumschlag das Problem. Schon heute wird der Eurogate-Terminal, werden aber auch die HHLA-Terminals zu großen Anteilen mit Strom aus Windenergie betrieben und diese Entwicklung wird weitergehen. Das Problem ist die Industrie im Hafen. Die Norddeutsche Raffinerie, die Hamburger Stahlwerke und die Hamburger Aluminiumwerke im Hafen und die Hamburger Hoch- und S-Bahn sind die vier größten Stromfresser, sie verbrauchen mehr als 50 Prozent des gesamten Strombedarfs in Hamburg. Wie wollen Sie diesen riesigen Strombedarf klimaneutral herstellen, wenn wir bis heute nicht einmal den Bau der großen Windparks in Norddeutschland realisiert haben? Und wenn Umweltverbände gegen den Stromleitungsbau für Windparks durch den Nationalpark Wattenmeer klagen, was sich locker über 20 Jahre hinziehen kann, wie man von der Elbvertiefung weiß. Dann sind wir im Jahr 2040, die Leitungen sind nicht gelegt und die Windenergie kann die riesigen Mengen Strom nicht erzeugen. Da liegt das Kernproblem. Deshalb ist der klimaneutrale Hafen 2040 ein schönes politisches Ziel, das ich auch unterstütze, aber um es zu erreichen, müsste die Politik die Klagemöglichkeiten der Verbände einschränken und dafür fehlt der politische Wille.
Mal abgesehen von der HHLA-Chefin Angela Titzrath: Warum sind Frauen etwa auch bei Hafenwirtschaftsdebatten wie der Digitalisierung oder der Weiterentwicklung des Hafens zu neuen Wirtschaftszweigen und Erlösquellen so wenig präsent?
Es ist richtig, dass Frauen in der Hafenwirtschaft nicht in gleicher Weise in Führungspositionen vertreten sind wie Männer. Aber es gibt neben Frau Titzrath sehr taffe, durchsetzungsstarke Hafenmanagerinnen, über die wird nur so selten berichtet. Das Bewusstsein, dass es noch mehr Frauen sein sollten, ist vorhanden. Insofern wird sich das weiter entwickeln. Ich bin gegen jegliche Quotenregelung, aber für Förderung. Die große Herausforderung ist, Familie und Beruf in Einklang zu bringen.
Rot-Grün hat sich in den aktuellen Koalitionsverhandlungen auf den Bau eines Köhlbrandtunnels und auch der Autobahn 26, der A26-Ost, genannt Hafenquerspange, geeinigt. Das ist mehr, als Sie von Ihren liebsten Gegnern, den Grünen, erwarten durften. Sind die gar nicht so schlimm und wirtschaftsfeindlich, wie Sie immer behaupten?
Ich würde es anders formulieren. Es ist erstaunlich, dass die Grünen überhaupt auf den Gedanken gekommen sind, die A26-Ost in Frage zu stellen, denn sie ist bereits vor vielen Jahren zusammen mit den Grünen in Regierungsverantwortung beschlossen worden. Jetzt stellen die Grünen das alles wieder in Frage, weil Umweltverbände dagegen klagen. Das ist unehrlich, politisch unzuverlässig und auch töricht. Ich befürchte, dass der grüne Umweltsenator Jens Kerstan versuchen wird, weitere Stöcke in die Speichen zu stecken bei den weiteren Planungsschritten für die A26-Ost. Ich vertraue ihm nicht. Vertrauen ist wie Ebbe und Flut: Wenn es einmal verloren gegangen ist, ist es weg.
Ich befürchte, dass der grüne Umweltsenator Jens Kerstan versuchen wird, weitere Stöcke in die Speichen zu stecken bei den nächsten Planungsschritten für die A26-Ost.
Apropos „Stöcke in die Speichen stecken“. Auf dem neuen Stadtteil Grasbrook sollte ursprünglich ein komplett nachhaltiger moderner Wohnstadtteil entstehen. Die Hafenwirtschaft hat das verhindert, so dass der Grasbrook jetzt ein gemischtes Quartier mit klassischer Hafennutzung wie den Autoverladungen der Grimaldi-Reederei oder dem großen Südfrüchtekühlhaus von Edeka wird. Warum ist die Hafenwirtschaft so hartleibig gewesen?
Ich teile Ihre Auffassung, aber es gilt immer noch der alte Spruch: Der Hafen gibt, der Hafen nimmt. Die Politik war nicht bereit, unsere Gegenforderungen zu erfüllen, sprich: Uns als Ausgleich für die Unikai-Fläche auf dem Grasbrook Ersatzflächen zur Hafenerweiterung in Moorburg zur Verfügung zu stellen. Insofern müssen Sie andere kritisieren, nicht die Hafenwirtschaft. Der Hamburger Hafen darf nicht klein gemacht werden, er ist unser Lebenselixier.
Damit die HafenCity an den neuen Grasbrook für Fußgänger, Schüler und Radfahrer sowie Notdienstfahrzeuge gut angebunden wird, soll es eine Brückenverbindung über die Elbe geben. Sie und der Hafen sind dagegen, weil sie die aktuellen Liegeplätze für die Auflieger-Schifffahrt, Pötte die vorübergehend keinen Auftrag haben, erhalten wollen. Können die Schiffe nicht auch woanders liegen?
Natürlich können die auch woanders liegen und wegen solcher Liegeplätze eine Stadtentwicklung zu behindern, ist in der Güterabwägung nicht sinnvoll. Es gibt andere Möglichkeiten etwa im mittleren Freihafen. Aber um so etwas zu entwickeln, bräuchte die HPA ein Konzept und müsste größer, vorausschauender und umfassender denken, als sie es tut. Sie hat kein Konzept.
»Anfangs wurde in der HafenCity noch großzügig und abwechslungsreich gebaut, dann aber kam leider die HafenCity Hamburg GmbH mit dem rein ökonomischen Prinzip, dass ein Grundstücksverkauf die gesamte Infrastruktur finanzieren muss. Das war ein großer Fehler.«
Gefällt Ihnen denn die HafenCity?
Da bin ich gespalten. Die grundsätzliche Idee ist gut, sie ist aber architektonisch zu schuhkartonmäßig geworden – wie Rittersport: quadratisch, praktisch, gut. Es fehlt das Liebenswerte. Wenn man sich in 100 Jahren diese Planung ansieht, wird man sagen: Das hätte man anders machen können. Anfangs wurde in der HafenCity noch großzügig und abwechslungsreich gebaut, dann aber kam leider die HafenCity Hamburg GmbH mit dem rein ökonomischen Prinzip, dass ein Grundstücksverkauf die gesamte Infrastruktur finanzieren muss. Das war ein großer Fehler. Das Ergebnis ist verdichtete Bebauung, eng, schattig, dunkel. Und es war auch ein Fehler, eine derart große Fläche wie das südliche Überseequartier an nur einen Entwickler zu vergeben.
Warum?
Das hätte nie passieren dürfen, es hätte stattdessen kleinteiliger geplant werden müssen. Der Geschäftsführer der HafenCity Hamburg GmbH, Herr Bruns-Berentelg, ist für mich im Übrigen auch kein redlicher Gesprächspartner, seitdem er sich nach der gescheiterten Olympia-Bewerbung über vereinbarte Pläne zur Entwicklung von Hafenflächen hinweggesetzt und nie das Gespräch mit der Hafenwirtschaft gesucht hat. Das ist nicht hanseatisch.
Sie sind der Lautsprecher des Hafens, doch zugleich weiß man wenig über Sie persönlich. Wie leben Sie eigentlich privat?
Ich bin seit 1983 mit meiner ersten Liebe verheiratet, die ich als 17-Jähriger kennengelernt habe. Wir haben zwei Kinder, die 29 und 31 Jahre sind und drei Enkelkinder im Alter von drei Jahren, einem Jahr und neun Monaten. Ganz solide und glücklich. Harmonie ist mir wichtig.
Wo und wie können Sie als gebürtiger Hamburger besonders gut abschalten?
Mir geht das Herz auf, wenn meine Frau und ich am Wochenende mit dem Fahrrad an die Elbe fahren oder ich mit meiner Familie einen Spaziergang mache über die Landungsbrücken. Allein der Duft der Elbe und des Hafens wecken bei mir so viele Kindheitserinnerungen. Hamburg ist eine so tolle Stadt. Und wir müssen alles daransetzen, dass es so bleibt. Das treibt mich an und macht mir Freude.

und Christiane Krämer (Pressesprecherin Hamburg Süd; v.l.n.r.)
bei dem Kunst-Projekt. © Wolfgang Timpe
Worauf könnten Sie in Ihrem bislang erfolgreichen Managerleben gut verzichten?
Auf so manche Eskapaden der Umweltverbände.
Für Kritik im Klartext sind Sie ja bekannt. Können Sie eigentlich gut leben mit dem Bad-Boy-Image?
Ja, damit habe ich kein Problem. Die Stigmatisierung ist ein politisches Kampfinstrument, das schon von den Nazis bis zur Perfektion beherrscht wurde. Wer sich davon beeinflussen lässt, hat verloren. An mir prallt das ab. Mir geht es um die sachlich-fachliche Auseinandersetzung.
Wo halten Sie sich in Hamburg am liebsten auf?
Auf der Halbinsel Entenwerder ist es wunderschön und ich bin gern im Marienthaler Gehölz, wo ich auch wohne.
Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Meine Frau und die Hamburger Verfassung.
Haben sie eigentlich Vorbilder?
Ich habe Leitbilder, keine Vorbilder. Ein Leitbild ist für mich die größte Errungenschaft, die wir nach dem schrecklichen Nationalsozialismus geschaffen haben: das fantastische Grundgesetz mit seinem Wertekanon. Ein weiteres Leitbild von mir ist ein friedliches menschliches Miteinander trotz aller Gegensätze und unterschiedlichen Überzeugungen. Auseinandersetzungen müssen sein, aber man muss sich auch vertragen und zusammen ein Bier trinken können.
Apropos Container: Was war Ihr kuriosestes Erlebnis und wie viele verschwinden spurlos pro Jahr?
Es verschwinden Tausende von Containern auf den Weltmeeren, aber im Gegensatz zu früher schwimmen die nicht mehr und stellen kein Hindernis mehr für die Segelschifffahrt dar. Heute sind sie mit einem Loch und Gummipfropfen versehen, der sich bei Wasserberührung auflöst, so dass der Container mit Wasser geflutet wird und sinken kann.
Haben Sie eigentlich ein Lebensmotto?
Ja, es lautet: sehr analytisch sein; genau erkennen, wo die Gefahren sind, dann kann man ihnen begegnen, aber im Grunde optimistisch sein und lebensfroh. Das Leben bejahen, weil es so schön ist. Warum sollen wir uns das vermiesen?!
Wenn Sie Gunther Bonz in drei Worten beschreiben sollen?
Ich bin ich.