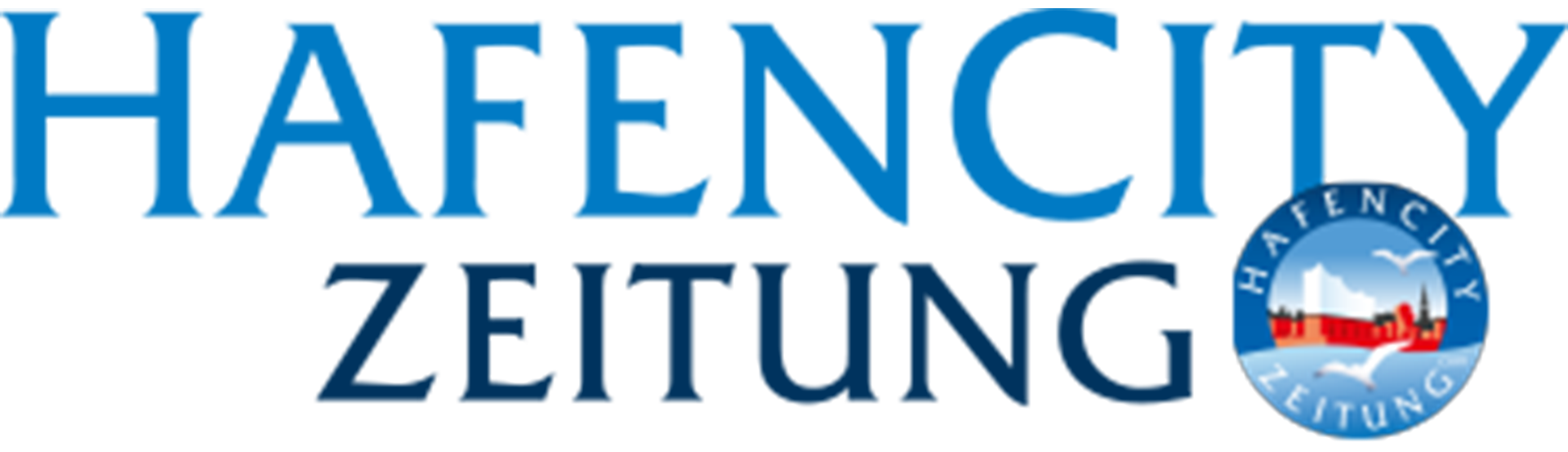Bezirkschef Falko Droßmann über Corona-Krise, Verantwortung und den neuen Grasbrook
Dieses Interview gibt es auch als Audio-Version im Podcast “Redefluss”
Herr Droßmann, die wichtigste Frage zuerst: Die Corona-Kurve der Neuinfizierten geht kontinuierlich nach unten. „Flatten the curve“ ist erfolgreich. Österreich und Dänemark lockern. Wir machen das in Hamburg defensiver. Wann lockern wir richtig? Wir müssen dann schon unterscheiden. Vielleicht ist es so, dass über ganz Hamburg die Neuinfektionen sinken. In Hamburg-Mitte ist das anders. In Hamburg-Mitte steigen wir derzeit relativ stark an. Zuerst hatten wir in Hamburg-Mitte, also unseren Stadtteilen Wilhelmsburg und Billstedt mit relativ wenig Ski-Rückkehrern weniger Fälle als in anderen. Aber gerade in unseren großen Wohnstadtteilen, wo Menschen in großen Familienverbänden zusammenleben, müssen viele Menschen in Quarantäne, wenn es einen positiven Fall gibt. Und mehr Menschen infizieren sich auch. Das ist für die ganze Stadt nicht signifikant, aber für Hamburg-Mitte durchaus ein Thema. Es geht darum, die lebensrettenden medizinischen Infrastrukturen funktional zu halten. Alles, was diesem Zweck dient, ist derzeit sinnvoll. Wenn Menschen auf die Intensivstationspflege und künstlich beatmet werden müssen, muss die Möglichkeit dafür existieren. Die besteht in Hamburg. Aber wir sollten größere Lockerungen auch nicht vor der Zeit herausfordern.
Foto oben: „Gerade in migrantischen Communities, wo junge, starke Männer zusammenstehen und glauben, vom Coronavirus nicht erfasst werden zu können, mussten wir sehr intensiv, auch zusammen mit der Polizei, um Verständnis werben“, so Bezirkschef Falko Droßmann. © Thomas Hampel
Große Sorgen haben die kleinen Selbständigen, die kleinen Einzelhändler, die ja am härtesten getroffen werden, weil sie trotz der Soforthilfe nicht wirklich überleben können. Gastronomen zum Beispiel möchten unter Einhaltung aller Abstandsregeln öffnen, damit sie irgendeine Art von Umsatz haben, auch wenn nur zehn Tische besetzt sind. Was halten Sie davon? Das ist keine politische Frage und keine Frage der Verwaltung. Ein Außerhausverkauf ist ja möglich und gerade in der HafenCity sehen wir, dass Restaurants Lieferservices anbieten. Da wäre die Solidarität gefordert, den zu nutzen. Es geht nicht darum, den Unternehmen in irgendeiner Form zu schaden, sondern die Unternehmen, aber auch die Kunden zu schützen. Jeder von uns will doch, dass die Corona-Maßnahmen so schnell wie möglich aufhören. Aber es muss auch verantwortbar sein. Dass es gerade bei den kleinen Gewerbetreibenden in der HafenCity, aber auch in Hamm, in Horn, in Billstedt um die Existenz geht, ist uns klar. Deshalb hat Hamburg ja auch das Notfall-Programm aufgelegt.

in der HafenCity im Grasbrookpark (Bild o.), Lohsepark und im Baakenpark:
„Die Häuser sollen jetzt in eine Stiftung übergehen, die wieder
von Anliegern finanziert werden muss. Das ist sozialpolitisch hochgradig erbärmlich.“
© ARGE_Hoffmann_Schlüter_Zeh
Sie sitzen jeden Tag in Schaltkonferenzen zusammen mit den Bezirken oder Teilen des Senats. Wo ist das drängendste Problem? Das größte Problem ist, dass das Virus immer noch aktiv ist. Und in Hamburg-Mitte sind es die Pflegeheime, um die wir uns jetzt vorrangig kümmern müssen.
Eine Online-Bürgerbeteiligung ist klug für eine Bevölkerung, die weiß, worum es geht. Aber 300 Meter vom Grasbrook entfernt liegt der ärmste Stadtteil Hamburgs, die Veddel, mit einer Migrantenquote von über 90 Prozent. Von denen hat sich keiner virtuell beteiligt.“
Bezirkschef Falko Droßmann zur Planung beim neuen Stadtteil Grasbrook
Sie sind für 19 Stadtteile verantwortlich. Wo unterscheidet sich die HafenCity von den anderen Stadtteilen? Jeder Stadtteil braucht seine eigene Ansprache. Auf der Veddel zum Beispiel war es schon eine Herausforderung für uns, dem einen oder anderen Gastronomen klar zu machen, dass er seinen Laden schließen muss. Da gab es viele Diskussionen vor Ort und teilweise hat das auch erst unter Androhung höchster Zwangsgelder zum Erfolg geführt. Gerade in migrantischen Communities, wo junge, starke Männer zusammenstehen und glauben, vom Virus nicht erfasst werden zu können, mussten wir sehr intensiv, auch zusammen mit der Polizei, um Verständnis werben.

im Zentrum der Halbinsel und der vorgelagerten „Peking“ als
Flaggschiff des neuen Deutschen Hafenmuseums. © Herzog & de Meuron
und Vogt Landschaftsarchitekten

16.000 Arbeitsplätzen mit einer begrünten Brücke zur Veddel. Falko Droßmann: „Ich weiß nicht, ob es klug ist, einen Stadtteil zu bauen und nicht die Menschen zu beteiligen,
die 300 Meter weiter wohnen. Der Bezirk Hamburg-Mitte wird sich hier massiv einschalten und darauf hinweisen, dass wir von der städtischen HafenCity GmbH erwarten,
dass solche Flächen mitgedacht werden.“ © HafenCity Zeitung / Wolfgang Timpe
Apopos Polizei: Sie sind Berufsoffizier, zurzeit für die politische Arbeit freigestellt. Hilft die Bundeswehr-Disziplin bei der aktuellen Amtsführung unter dem Corona-Virus? (lacht) Ich fürchte fast, dass einige meiner Mitarbeiter Ja sagen würden. Aber wir sind ja keine militärische Einheit, sondern ein Bezirksamt mit über 1.600 Mitarbeitenden. Da geht es darum, die Mitarbeiter mitzunehmen, denn auch Verwaltung ist vor Angst nicht gefeit, hier arbeiten auch nur Menschen. Wir mussten zuerst mal das Verwaltungshandeln auf diese Corona-Situation einstellen. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat ja die Besonderheit, dass weit mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter nicht in Hamburg lebt, sondern in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Als dort die Kitas geschlossen wurden, stellte sich erst einmal die Frage, ob es dort eine Notfall-Betreuung gibt. Und im Kundenzentrum des Bezirksamts haben sich etwa 15 Prozent krankgemeldet. Das war schon eine Herausforderung, aber jetzt ist das wieder in Ordnung und die Arbeit des Bezirksamtes ist gesichert.

in einem Club war, ist schon eine ganze Zeit her. Der Fisch stinkt immer vom Kopf her!
In einen Club gehe ich zurzeit nur, wenn es ein illegaler ist und wir den
stilllegen müssen.“ © Wolfgang Timpe
Hamburg Wasser hat vermeldet, dass der Peak beim Duschen nicht mehr um 7.45 Uhr ist, sondern erst um 10 Uhr – sicher, weil viele Menschen derzeit im Homeoffice arbeiten. Haben Sie das Gefühl, dass Homeoffice unsere Arbeitsweise verändert? Auch da haben wir eine Besonderheit. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte ist ja vor bummelig anderthalb Jahren vom City-Hof in die Caffamacherreihe gezogen. Ich hatte mich damals entschieden, auf Desktop-Rechner zu verzichten, soweit es geht, und nur noch Laptops anzuschaffen. Hintergrund war, dass bei uns 70 Prozent unserer Mitarbeiter Frauen sind und wir das Bezirksamt mit den meisten berufstätigen Müttern sind. Mir ist egal, wo meine Mitarbeitenden ihre Arbeit machen. Der Gedanke, dass ein Bebauungsplan oder Bericht in der Amtsstube geschrieben werden muss, ist aus meiner Sicht anachronistisch. Mir ist das Arbeitsergebnis wichtig und nicht, wo die Arbeit stattfindet, außer natürlich, wenn das mit Öffnungszeiten verbunden ist. Das hat uns in die Lage versetzt, relativ schnell den Großteil unserer Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. An Telefon- und Videokonferenzen mussten sich viele erst gewöhnen, aber es funktioniert wirklich gut und die moderne IT-Ausstattung dieses Bezirksamtes hat uns viele Dinge leichter gemacht.
Falko Droßmann
wurde am 11. Dezember 1973 in Wipperfürth bei Köln geboren,
ging mit 17 Jahren zur Polizei in Nordrhein-Westfalen und holte sein Fachabitur nach. Er studierte an der Universität der Bundeswehr
in Hamburg Geschichtswissenschaften, schloss mit Magister Artium ab und wurde Berufsoffizier. Der 46-Jährige ist seit 2001 in der SPD und wurde 2011 Chef der SPD-Bezirksfraktion in Mitte. Seit dem 25. Februar 2016 ist er Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte und seit 1. Oktober 2017, dem Tag
der Einführung der Ehe für alle, mit seinem Partner Danny verheiratet.
Apropos leichter: Falko Droßmann ist bekannt dafür, dass er im Leben bei aller Arbeit das Feiern und Lachen nicht vergisst. Hat der lebensfrohe Falko Droßmann im Moment umständehalber Sendepause? (lacht) Ich muss das mal relativieren. Ich gehe auch auf die 50 zu. Das letzte Mal, dass ich im Club war, ist schon eine ganze Zeit her. Der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Und wenn ich hier wehleidig und ängstlich Unsicherheit verbreitend durch mein Bezirksamt laufe, kann ich von meinen Mitarbeitern nicht erwarten, dass sie das Gegenteil tun. Ich habe zu funktionieren wie alle anderen Leitungskräfte im Bezirksamt, auch um Vorbild zu sein für die Mitarbeitenden. In einen Club gehe ich zurzeit nur, wenn es ein illegaler ist und wir den stilllegen müssen.

Wir haben keine soziale Infrastruktur. Wunderschöne Architektur ersetzt keinen kostenlosen Seniorentreff, kein Haus der Jugend und keine Angebote der Mütterberatung.
In der HafenCity fehlt all das.“ © Thomas Hampel
Es gibt bestimmt auch schöne Momente im Bezirksamt. Wird da noch geheiratet? Ja, es passieren auch super Dinge. Wir im Bezirk Hamburg-Mitte sind zwar nicht der größte und auch nicht der beste, aber der mit dem meisten Spaß und dem meisten Rock’n’Roll. Schön ist es zu sehen, wenn Verwaltung funktioniert und sie den Ärmsten der Armen helfen kann. Jeden Morgen ist zum Beispiel ein Notschalter für Menschen geöffnet, die staatliche Unterstützung bekommen, aber über kein Konto verfügen. Die bekommen hier eine Bar-auszahlung, auf die sie angewiesen sind. Schön ist, dass es gerade diese Menschen sind, die das sehr zu würdigen wissen, die sich auch bedanken. Geheiratet wird auch noch. Allerdings nur mit dem Brautpaar selbst. Weniger schön ist, dass wir auch hässliche Debatten haben, zum Beispiel mit Menschen, die bei uns auftauchen und jetzt zwingend ihren Angelschein haben wollen. Wir werden all diese Dienstleistungen nachholen und können derzeit auch relativ viel auf dem Postweg erledigen. Aber eine persönliche Vorsprache muss nicht sein.
Ich werde nicht Gelder für die Sanierung von Spielplätzen in St. Georg, Hamm, Billstedt oder Mümmelmannsberg abziehen, um den Zustand der Grünanlagen in der HafenCity aufrecht zu erhalten. Das muss man den Mitgliedern der Bürgerschaft auch so klar sagen. Duschen, ohne nass zu werden, geht nicht.“
Falko Droßmann zu den teuren Unterhaltskosten öffentlicher Flächen in der HafenCity
Apropos schöne Atmosphäre: Von den Hochintellektuellen bis zu den einfachen Menschen aus dem Stadtteil verbindet viele die Hoffnung, dass Corona sozusagen zu einem menschlicheren Kapitalismus führt. Haben Sie die auch oder ist dann nach einer gewissen Zeit alles wieder wie vorher? Das ist eine kluge Frage, die aber weit über die Tätigkeit eines Bezirksamtsleiters hinausgeht. Ich glaube, dass das zwingend erforderlich ist, und auch, dass manche Debatten, die ich in den letzten Jahren führen musste, der Vergangenheit angehören. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Das Bezirksamt Hamburg-Mitte beschäftigt drei Vollzeit-Mitarbeiter für den Katastrophenschutz, wofür es immer wieder Kritik gab. Das wird man nach Corona anders beurteilen. Oder die zentrale Tuberkulosestelle für ganz Hamburg, die bei uns angesiedelt ist, mit großen Röntgengeräten, mit Fachärzten, um für einen Tuberkulose-Ausbruch gewappnet zu sein. Da wurde auch sehr oft diskutiert, ob wir das brauchen. Ich glaube, die unselige Debatte, im öffentlichen Dienst immer weiter einzusparen zugunsten von Computersystemen und ähnlichem, muss deutlich hinterfragt werden. Was das normale wirtschaftliche Leben angeht, wäre es meine Hoffnung, dass Produkte der Daseinsvorsorge wieder mehr den staatlichen Bedarf berücksichtigen.
Ich musste 20 Euro für einen Mundschutz bezahlen, der normalerweise 70 Cent gekostet hätte. Ja, da stellt sich die Frage: Ist Angebot und Nachfrage wirklich das, was unser Land regieren sollte, oder müssen wir nicht in der staatlichen oder städtischen Gemeinschaft dafür sorgen, dass wir solche Dinge immer zur Verfügung haben? Das müssen wir mehr diskutieren.
Dann bleibt mir jetzt nur ein klarer Cut: Sie leben seit einem Jahr in der HafenCity. Wie haben Sie sich inzwischen eingelebt? Oh ja, es ist immer noch anders als das, wo ich vorher gewohnt habe. Ich habe in Billstedt gewohnt und dann in Horn, habe lange in St. Georg gelebt. Die soziale Kontrolle nach dem Motto „Macht er alles richtig oder nicht?“ ist in der HafenCity schon höher.
Also sind wir doch ein Dorf in der HafenCity. Durchaus. Und es gibt viele Menschen mit vielen Meinungen. Das finde ich gut. Aber auch in der HafenCity gibt es viele Menschen, die ihre Meinung für die jeweils einzig gültige halten. Und daran muss ich mich sowohl im Privatleben als auch im politischen Leben noch gewöhnen. Die HafenCity ist ein Stadtteil, der gerade erst entsteht und wo nicht wie in den anderen Stadtteilen über Jahrzehnte soziale Kontakte und soziale Treffpunkte wachsen konnten. Und die HafenCity hat Defizite. Daraus mache ich keinen Hehl. Wir haben keine soziale Infrastruktur. Wunderschöne Architektur, über die man übrigens auch streiten kann, ersetzt keinen kostenlosen Seniorentreff, kein Haus der Jugend und keine Angebote der Mütterberatung. In der HafenCity fehlt all das und ich befürchte fast, dass wir beim Grasbrook denselben Fehler machen. Ich würde mir wünschen, dass wir alle dazulernen.
Drei Gemeinschafthäuser im Grasbrook- und Lohsepark sowie im Baakenhafenpark werden ja demnächst gebaut. Ja, aber es sind keine öffentlichen Gebäude, sondern die Häuser sollen jetzt in eine Stiftung übergehen, die wieder von Anliegern finanziert werden muss. Das ist sozialpolitisch hochgradig erbärmlich. Das sind Räume, die Nachbarn mieten können, aber eine Mütterberatung kann ich dort zum Beispiel gar nicht durchführen, weil Räume für Büros, für den Rückzug von Mitarbeitern fehlen. Insofern sind das Gemeinschaftshäuser im Sinne von Nachbarschaftstreffs, aber keine Räume, um eine gute soziale Arbeit stattfinden zu lassen. Das ist ja nicht möglich, denn wir haben unten einen kommerziellen Raum und oben einen großen Raum. Ob das wirklich mit modernen Sozialstandards übereinstimmt, ist eine andere Frage.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie auf dem Grasbrook eine ähnliche Entwicklung befürchten. Da wird in drei Jahren erst angefangen zu bauen. Es muss doch möglich sein, mit der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH zu reden, wie die Interessen, die Sie gerade formuliert haben, Berücksichtigung finden? Natürlich bringen wir das jetzt in die Diskussion ein. Aber dieser Wettbewerb zum Grasbrook, der jetzt gerade abgeschlossen wurde, war ein Architektenwettbewerb. Da geht es wieder um Architektur. Über den Sozialraum wird nicht diskutiert. Da sitzen keine Sozialpolitiker. Es gab ja auch die Möglichkeit der Online-Beteiligung, was sicherlich klug ist für eine Bevölkerung, die weiß, worum es geht, und sich beteiligen kann. Aber 300 Meter vom Grasbrook entfernt liegt der ärmste Stadtteil Hamburgs, die Veddel, mit einer Migrantenquote von über 90 Prozent. Von denen hat sich keiner virtuell beteiligt.
Ich weiß nicht, ob es klug ist, einen Stadtteil zu bauen und nicht die Menschen zu beteiligen, die 300 Meter weiter wohnen. Der Bezirk Hamburg-Mitte wird sich hier massiv einschalten und darauf hinweisen, dass wir von der städtischen HafenCity GmbH erwarten, dass solche Flächen mitgedacht werden. Ein weiteres Beispiel: Das Thema Sport verfolgt uns in der HafenCity schon seit Ewigkeiten. Wir haben keine große öffentliche Sportanlage. Und was ist mehr Sozialpolitik als Vereinssport? Jeder Fußballtrainer hat doch mehr Einfluss auf die Kinder als mein halbes Jugendamt. Das geht doch nicht.
Ein anderes Beispiel: Altglas. Seit einem Jahr versuchen wir in der HafenCity Glassammelstationen aufzubauen und mir werden die ganze Zeit irgendwelche Städtebau- und Architekturgründe entgegengehalten. Da muss man sich doch mal fragen, was mache ich hier eigentlich? Es geht nicht darum, die städtischen Entwickler nur zu kritisieren, die Architekten zu desavouieren und deren Leistung in Frage zu stellen. Aber es ist auch unsere Aufgabe, als Bezirk und Bezirksversammlung dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge besser gemacht werden und stärker berücksichtigt werden.
Einige ärgern sich in der HafenCity darüber, dass der Bezirk die Pflege der Grünflächen nicht übernehmen wollte, weil sie zu teuer ist. Warum haben Sie abgelehnt? Also ich muss mal mit der Fata Morgana aufräumen, dass der Bezirk etwas nicht übernehmen wollte. Ich weiß, dass das mal kolportiert worden ist. Es stimmt aber nicht. In den Verträgen steht, dass die HafenCity Hamburg GmbH die Flächen ab einem gewissen Moment per Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft an den Bezirk übergibt. Das passiert stufenweise, bei den Grünanlagen sind wir noch gar nicht angekommen. Wenn wir dort ankommen, übernimmt der Bezirk sie natürlich. Aber dann müssen uns die Bürgerschaft und der Senat auch die Möglichkeit geben, sie zu unterhalten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, die Pflege einer Grünfläche im gesamten Bezirk Hamburg-Mitte kostet 36 Cent pro Jahr. In der HafenCity kostet sie sechs Euro pro Jahr, weil da einfach eine andere Qualität hergestellt worden ist. Der Wasserspielplatz im Grasbrookpark, den wir haben, ist toll. Aber er ist auch teuer. Und ich werde nicht Gelder für die Sanierung von Spielplätzen in St. Georg, Hamm, Billstedt oder Mümmelmannsberg abziehen, um den Zustand der HafenCity aufrecht zu erhalten. Das muss man den Mitgliedern der Bürgerschaft auch so klar sagen. Duschen, ohne nass zu werden, geht nicht. Wenn wir also den Zustand der HafenCity erhalten wollen, muss die Stadt auch das Geld dafür zur Verfügung stellen.
Das war jetzt eine Steilvorlage, um wieder bei etwas Persönlichem zu landen. Fehlt am Kaiserkai die Dönerbude für Falko Droßmann? (lacht) Also nö, die fehlt nicht. Ich mag Döner, das gebe ich zu. Aber ob da eine Dönerbude hinpasst, weiß ich nicht. Aber es ist schon ziemlich hochpreisig und ich weiß, dass auch viele Familien in der HafenCity sich überlegen, ob sie in der Umgebung Essen gehen. Aber mit Dominos sitzt ja einer der umsatzstärksten Pizza-Lieferanten in der HafenCity. Der wurde schon vor Corona überrannt, weil er einfach günstig nach Hause liefert. Ich glaube, das entwickelt sich aber – gerade mit dem Entstehen der östlichen HafenCity, wo wir familiengerechten Wohnraum geschaffen haben, wo sich die Genossenschaften und die Saga engagieren.
Eine abschließende Frage zum Stichwort Freizeit. Am Ufer der Bille haben Sie einen Kleingarten mit Hütte und Boot. Geht Käptn‘ Droßmann auf Wassertour oder dösen Sie nur im Strandkorb auf dem Steg? (lacht herzlich) Ich habe tatsächlich seit einigen Wochen ein Boot, aber leider keinen Bootsführerschein. Wir haben ein kleines Boot mit einem Fünf-PS-Außenborder gekauft und sicherlich werden wir zu zweit mal über die Bille fahren. Und wirklich nur zu zweit, denn die Corona-Rechtsverordnungen gelten auch in Kleingärten.
Noch etwas Persönliches. Als Sie Ihren Mann Danny geheiratet haben, wurde im Hafen auf der Rickmer Rickmers gefeiert. Machen Sie sich Sorgen um den Hafen wegen Corona? Wir haben auf der Rickmer Rickmers nur den standesamtlichen Teil gemacht. Gefeiert haben wir natürlich abends auf St Pauli. Aber die Corona-Hafen-Frage ist tatsächlich: Wann machen die internationalen Routen wieder auf, also der Asien-Europa-Loop? Das existenzielle Problem trifft derzeit weltweit alle Häfen.
Lieber Herr Droßmann, worauf freuen Sie sich nach der Corona-Krise? Oh, das ist schwierig. Ich würde mich mal über einen freien Tag freuen. Also einen Tag, an dem ich keine Krisensitzung habe, an dem nicht an einer Million Ecken gleichzeitig etwas zu erledigen ist. Einfach ein Tag, an dem ich mein Funktelefon ausschalten kann. Das wünsche ich mir.
Das Gespräch führten Wolfgang Timpe und Melanie Wagner