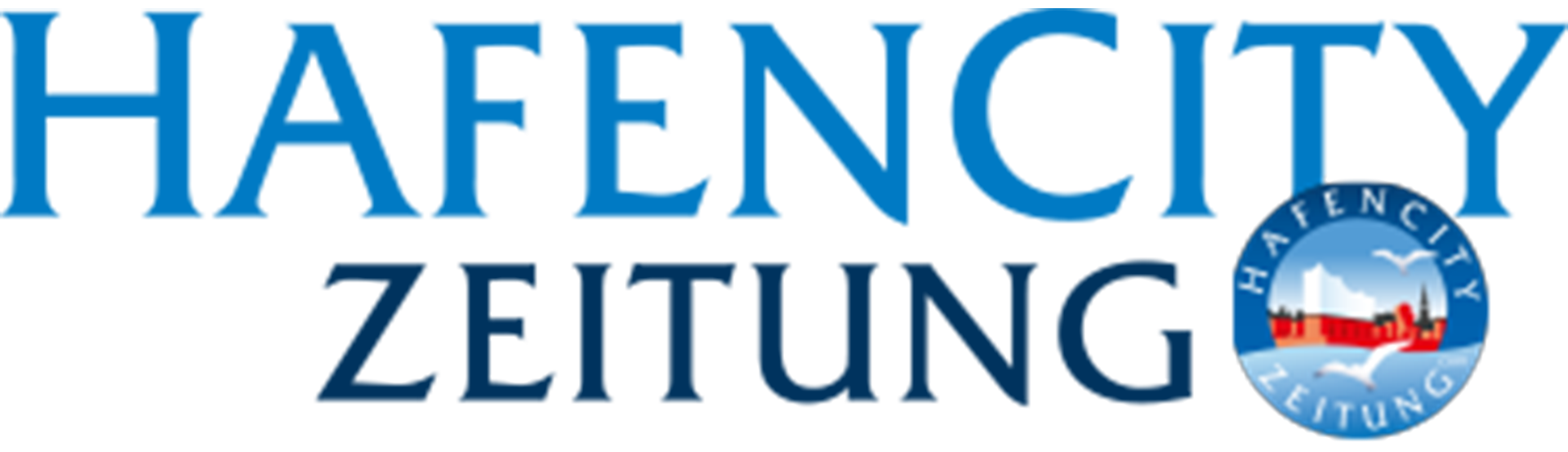Coaching. Wie kleine Änderungen in der Wortwahl aus Frustration Motivation machen
Ein Wort ist rasch gesagt, bleibt aber lange im Gedächtnis“, so besagt ein chinesisches Sprichwort. Spätestens wenn ein Missverständnis gravierende Folgen nach sich zieht, etwa Probleme am Arbeitsplatz oder in der Beziehung, oder wir jemanden durch eine unbedachte Äußerung kränken, wird es uns schmerzlich bewusst: Worte können schärfer schneiden als ein Schwert und gute Stimmung im Handumdrehen zunichtemachen. Dies gilt nicht nur in der Kommunikation mit anderen. Dass unsere Sprache unser Denken, die Gefühle und schließlich das Verhalten beeinflusst, erachtet die Wissenschaft schon lange als Fakt. Und da unser Verhalten bestimmt, welche Ergebnisse wir erzielen, lohnt es sich, die Sprache einmal näher unter die Lupe zu nehmen.
Foto oben: Beflügelnde Worte „Ich muss“-Sätze engen ein, „Ich will“-Sätze befreien: Was auch immer wir tun, was uns geschieht – wir bewerten alles um uns herum, alles in uns und alles an uns. Und oft sind wir der Meinung, dass in unserem Leben Dinge „schlecht“ sind, nur weil sie anders laufen, als wir es erwartet haben. © Pexels auf Pixabay
Eine alltägliche Situation: Man muss dringend noch das Auto in die Werkstatt fahren, den Abwasch und überhaupt jede Menge erledigen, aber am Abend wollte man eigentlich mit Freunden ins Kino – schon der Gedanke an die ganzen To-dos löst Stress aus. Ein einfacher Trick kann helfen, der gleichzeitig für mehr Motivation sorgt. Wir ersetzen das Wort „aber“ durch „und“. Statt zu sagen oder zu denken: „Ich möchte ins Kino gehen, muss aber noch das Auto wegbringen und mich um den Haushalt kümmern“, formulieren wir: „Ich möchte ins Kino gehen und muss noch das Auto wegbringen und mich um den Haushalt kümmern.“ Der Unterschied ist fein, aber entscheidend.
Im ersten Satz schwingt der Gedanke mit, dass man zwar gern ins Kino möchte, aber es wohl sowieso nicht schafft. Das aber bringt uns in eine vermeintliche Konfliktsituation, und wir bemühen uns gar nicht erst, einen Ausweg zu suchen. Das und hingegen schickt das Gehirn quasi los, um einen Lösungsweg zu finden, weil diese Formulierung die Annahme beinhaltet, dass es einen solchen gibt. Das Gehirn denkt dann automatisch darüber nach, wie es mit beiden Teilen des Satzes umgehen kann. Meist findet sich dann tatsächlich eine Lösung. Den Abwasch könnte beispielsweise jemand anderes machen, oder man schaut sich einen kürzeren Film an und kümmert sich erst anschließend um das dreckige Geschirr. Ein ähnlich großer Motivationskiller ist das Wort müssen. Alternative: An die Stelle von „Ich muss …“ treten „Ich beschließe …“-Sätze. Dies ist deshalb so effektiv, da es uns die Tatsache bewusst macht, dass wir alles in unserem Leben freiwillig und aus eigener Entscheidung tun – selbst Dinge, die wir als unangenehm oder Verpflichtung empfinden.
Mache ich dann nur noch, worauf ich Lust habe? Alles ist rosa? Happy life? Nein. So funktioniert es nicht. Und darum geht es nicht. Es geht um die eigene innere Einstellung, um die Wahl der Entscheidung und die daraus folgende Konsequenz.
Das „Ich muss“ nimmt mir einen Teil meiner Verantwortung und schiebt den „schwarzen Peter“ jemand oder etwas anderem zu. Geld muss ich wegen der Familie verdienen, arbeiten muss ich wegen des Geldes, das Haus muss ordentlich sein, damit die Mitmenschen nicht schlecht über mich denken. Ich muss mich so verhalten, weil ich es so als Norm oder Regel kennengelernt und als Glaubenssatz verinnerlicht habe. Wirklich?
Wenn ich etwas „beschließe“, verändert dies das eigene Empfinden enorm. Ich habe plötzlich eine andere Kontrolle über die Dinge, die ich tue. Ich beschließe, meine Steuerunterlagen zu machen, ist die eigene freie Entscheidung, diese Aufgabe anzugehen. Ich beschließe, ins Fitnessstudio zu gehen, gibt mir ein ganz anderes Gefühl als: Ich muss, weil ich schließlich die Mitgliedsgebühr bezahle.
Was auch immer wir tun, was uns geschieht – wir bewerten alles um uns herum, alles in uns und alles an uns. Und oft sind wir der Meinung, dass in unserem Leben Dinge „schlecht“ sind, nur weil sie anders laufen, als wir es erwartet haben. Aber hat dies nicht eher damit zu tun, dass eine Situation anders geschieht, als wir es uns mit unserer festgefahrenen Vorstellung wünschen? Und anstatt an dem, was passieren soll, herumzubasteln, könnten wir vielleicht einfach flexibler werden in unseren Vorstellungen. Ob etwas tatsächlich schlecht ist, merken wir ohnehin häufig erst sehr viel später. Anstatt also das Etikett „schlecht“ auf etwas zu packen, könnten wir „anders als erwartet“ verwenden. Ein entsprechender Satz kann dann lauten: „Das ist nicht gelaufen, wie ich es erwartet (oder erhofft) hatte“. Die Effekte dieses kleinen Wortspiels auf die Gefühle und das Verhalten könnten für positive Überraschungen sorgen. Andrea Huber
INFO
Andrea K. Huber ist Coachin im Leistungssport, hat sich auf Stressmanagement spezialisiert und berät Unternehmen und Privatpersonen in herausfordernden Situationen. Infos unter: www.andrea-huber-coaching.de