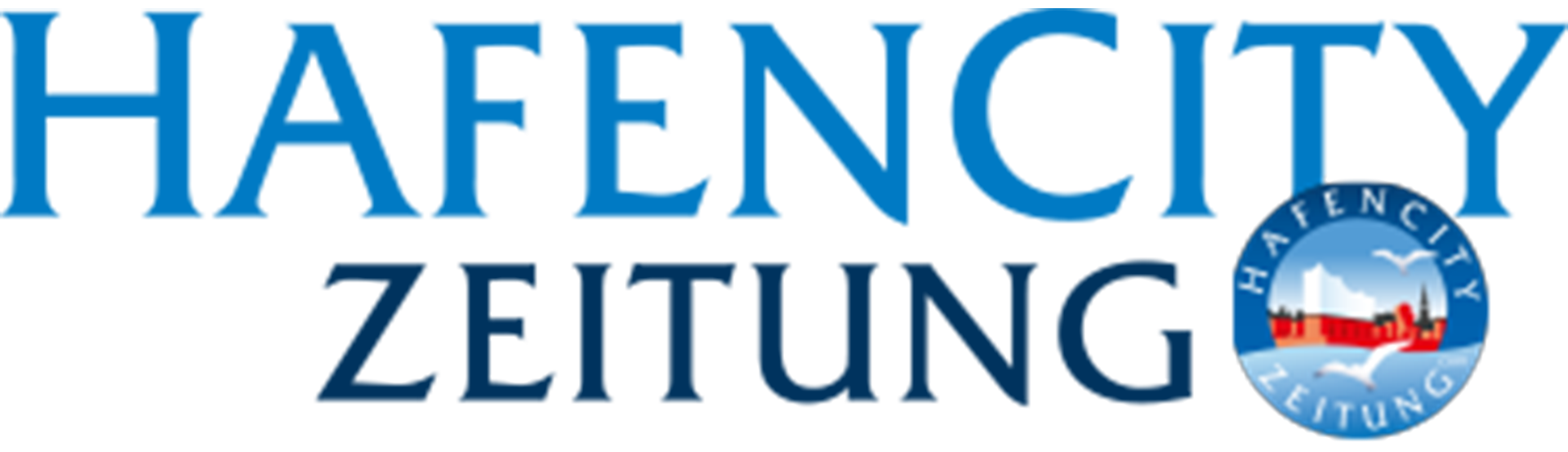Kultursenator Carsten Brosda im Gespräch mit HafenCity Zeitung-Redakteur Wolfgang Timpe über mutige Musik, schräge Oberhafen-Kunst und das Politische an der Kultur
Herr Brosda, sollten Sie nicht jeden Tag Hosianna! ausrufen, da Sie sich als Kultur- und Mediensenator hauptberuflich um das Wahre, Gute und Schöne kümmern dürfen? Es ist schon eine Freude, sich mit Kultur beschäftigen zu dürfen. Dabei geht es für mich weniger um das Wahre, Gute und Schöne, sondern mehr um den Zusammenhang in unserer Gesellschaft. Das, was Sinn produziert, ist oft schön, kann aber auch mal anstrengend sein. In jedem Fall ist es immer notwendig und das macht die Arbeit mit und für Kunst und Kultur so erfüllend. Ich rufe also nicht Hosianna, bin aber jeden Tag mit Begeisterung dabei.
(Foto oben: Oberhafen-Fan: „Die Halle 424 mit ihren Musikveranstaltungen und Ausstellungen, die Hanseatische Materialverwaltung oder die Galerien, Kreativbüros und Filmstudios – das alles zusammen ist schon richtig toll.“ Foto: Thomas Hampel)
Sind Sie als Kultursenator auch ein Manager gesellschaftlicher Konflikte? Es gehört zu Demokratien in offenen Gesellschaften, dass gerade die Kulturpolitik verschiedene Positionen miteinander und zueinander in Beziehung setzt. Wir verständigen uns in der Kulturpolitik auch darüber, wie wir es hinbekommen, verschieden zu sein und in der Gesellschaft trotzdem etwas Gemeinsames zu schaffen. In der Kultur ist das manchmal eindringlicher zu spüren und steht ganz vorne auf der Agenda, nicht nur als ein Teil von Rahmenbedingungen wie in der Politik.

viel Kraft für die Gesellschaft erwachsen.“ Foto: Thomas Hampel
Sie sind Präses der Behörde für Kultur und Medien. Das klingt eher nach Amt und weniger nach Kreativität. Wie definieren Sie Ihre Mitte? Als Behörde sind wir Ermöglicher, die Ressourcen, Rahmenbedingungen und Freiheiten sichern, ausbauen und zur Verfügung stellen, damit Kunst- und Kulturproduktion in der Stadt stattfinden kann. Das ist unsere Kernaufgabe, die zurzeit wieder wichtiger geworden ist.
Warum? Weil einige, die bestimmten, vorwiegend rechten gesellschaftlichen und politischen Strömungen nahestehen, die Freiheit von Kunst und Kultur nicht mehr als so selbstverständlich erachten und sie einschränken wollen.
Wir reden immer mehr auch über die Frage, was den Sinn und den inneren Zusammenhang einer Gesellschaft ausmacht. Das sind genuine Kulturfragen. Wir müssen uns ihnen stellen, um nicht den Rechtspopulisten das Feld zu überlassen.«
Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien
Was hat Sie zuletzt richtig geärgert? Als eine Partei jüngst gefordert hat, Kampnagel die Subventionen zu streichen und das Geld ins öffentliche Grün zu investieren, hat es mich schon sehr geärgert. Mich regt es zudem immer auf, wenn Menschen nicht in der Lage sind, miteinander zu reden. Und um ins Gespräch zu kommen, liefern Kunst und Kultur großartige Räume, weil sie uns mit ihrer Arbeit irritieren, inspirieren oder uns ganz persönlich auch emotional treffen. Daraus kann viel Kraft für eine Gesellschaft erwachsen. Es ist beeindruckend, dass Hamburg sich in den vergangenen Jahren wieder verstärkt darauf besonnen hat, dass die Stadt genau davon geprägt sein kann. Es gibt, nicht nur wegen der Elbphilharmonie, eine neue Hinwendung zur Kultur. Die Fragen in unserer Gesellschaft stehen einfach auf der Agenda: Was macht uns aus? Was hält uns zusammen? Wer sind wir eigentlich? Wie kommen wir mit der Identität unserer Gesellschaft eigentlich klar? Wie vereinbaren wir etwas Gemeinsames?
Dr. Carsten Brosda, Jahrgang 1974, ist Senator für Kultur und Medien in Hamburg sowie Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie und Co-Vorsitzender der Medien- und Netzpolitischen Kommission des SPD-Parteivorstandes. Nach einem Studium der Journalistik und Politikwissenschaft wurde er mit einer Arbeit über „Diskursiven Journalismus“ promoviert. Er war u. a. eiter der Abteilung Kommunikation des SPD-Parteivorstandes und arbeitet seit 2011 in Hamburg – zunächst als Leiter des Amtes für Medien, ab 2016 als Staatsrat für Kultur, Medien und Digitalisierung und seit Februar 2017 als Senator. Zudem ist er Gründungsvorsitzender der neuen Kulturminister-Konferenz. Carsten Brosda ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Geben Sie da den Ton an? Die Fragen müssen bearbeitet werden, aber nicht indem ein Senator seine Sicht der Welt einmal deklamiert und im besten Fall Zustimmung erntet. Ich bin ein Gesprächspartner und versuche mit Debattenbeiträgen, dafür das Klima zu schaffen. Die Beschäftigung mit diesen Fragen ist absolut notwendig.
In dem jungen, immer noch wachsenden Stadtteil HafenCity haben wir mit dem Konzerthaus Elbphilharmonie, der Gedenkstätte denk.mal Hannoverscher Bahnhof zur Erinnerung an deportierte Juden, Roma und Sinti und der Off-Kulturszene im Oberhafenquartier drei gänzlich unterschiedliche Spielorte der Kultur. Wofür schlägt Ihr Herz? Das Schöne an Hamburg ist die Dichte. Ich kann um eine Ecke gehen und bekomme einen ganz anderen Blick auf die Stadt, und sie fühlt sich plötzlich auch ganz anders an. Wenn ich unter der Brücke hindurch in den Oberhafen komme, lasse ich das Neubauareal HafenCity mit seiner klaren Strukturiertheit hinter mir und bin plötzlich in einem alten Güterbahnhof mit alten Lagergebäuden. Das windschiefe Haus der Oberhafenkantine verweist darauf: Ich tauche in eine völlig andere Welt ein. Das ist großartig! Und am anderen Ende der HafenCity gibt es mit der Elbphilharmonie den Knotenpunkt, an den jeder Besucher dieser Stadt strömt, an dem man viel Internationalität erleben kann. Diese Kontraste so nah beieinander zu erleben, lassen mein Herz für diese Stadt höher schlagen.

Das Deutsche Hafenmuseum, eine kulturelle Nutzung, wird das erste beschlossene Projekt auf dem Grasbrook sein.“ Foto: Thomas Hampel
Auch für die HafenCity? Wo fühlen Sie sich in Hamburg zuhause? Wenn ich an der Elbe stehe und auf den Hafen und den Fluss schaue. Das war mein Wow-Effekt, als ich das erste Mal in Hamburg gewesen bin. Mein Herz schlägt aber auch für die HafenCity. Meine leider verstorbene Vorgängerin Barbara Kisseler hat mal als HafenCity-Bewohnerin scherzhaft über den Stadtteil gesagt, als es noch keine einzige Kultureinrichtung der heute prägenden Art gab: Sie könne in keinem Stadtteil leben, in dem das kulturelle Zentrum der Edeka-Markt wäre. Das stimmt abstrakt für jeden Stadtteil, aber gerade für die HafenCity gilt es schon lange nicht mehr, denn hier passiert sehr viel im Bereich Kultur: die Elbphilharmonie, das im Entstehen befindliche Dokumentationszentrum am denk.mal Hannoverscher Bahnhof im Lohsepark, das Oberhafen-Quartier und die Arbeit der HafenCity-Kuratorin Ellen Blumenstein, die Kunst in den öffentlichen Raum bringt. Und es wird in den kommenden Jahren in der HafenCity noch viel passieren. Da bleibt dann nur noch die Frage, ob man lieber in einem Alt- oder Neubau wohnen möchte. Das ist eine persönliche Geschmacksfrage. Ich habe in beidem schon gelebt und kann beidem etwas abgewinnen.
Als Senator müssen Sie immer auch die Zukunft von Kultur vorausdenken und vorausplanen. Wohin geht für Sie die Reise des Hamburg-Leuchtturms Elbphilharmonie? Christoph Lieben-Seutter hat in den vergangenen Jahren einen herausragenden Job gemacht. Es wird jetzt die Aufgabe sein, das bislang erreichte Niveau zu halten. Nach anderthalb Jahren hat fast jedes große Orchester der Welt schon mal in der Elbphilharmonie gespielt und die bange Frage war zwischenzeitlich: Geht das so weiter? Aber das Schöne ist, dass gerne alle wiederkommen. Die Besonderheit des Großen Saals und seine Anziehungskraft wird noch eine lange Zeit tragen. Der absolute Hype mit einer 40-fachen Überbuchung pro Platz hat sich abgeschwächt, so dass man öfter Konzertkarten bekommt. Und wenn ich Elbphilharmonie und Laeiszhalle zusammen betrachte, ist meine Prognose, dass man künftig nüchterner auf die beiden herausragenden Säle und ihre jeweiligen außerordentlichen Qualitäten schauen wird. Konzerte, die heute im Großen Saal der Elbphilharmonie stattfinden, können in der Laeiszhalle gespielt werden, weil nicht mehr jeder Künstler fortwährend unbedingt in der Elbphilharmonie auftreten will und man auch in der Laeiszhalle das künstlerische Optimum des jeweiligen Abends erreichen kann.

auf den sich die Künstler einlassen müssen. Man muss ihn spielen und beherrschen
lernen wie ein Instrument.“ Foto: Hernandez
Welches Profil der Elbphilharmonie sehen Sie? Wir sollten die Vielfalt des Programms, die wir jetzt schon haben, halten. Die Elbphilharmonie muss auch auf Dauer ein Haus für alle bleiben. Und man wird weiter mutig mit dem Saal spielen, wozu er auch herausfordert. Im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg im nächsten Jahr zum Beispiel wird der Große Saal von Kent Nagano mit seinen Philharmonikern erneut mit einer Oper, der fünfeinhalbstündigen Komposition „Saint François d’Assise“ von Olivier Messiaen, bespielt . Der Saal hat eine Transparenz, Luftigkeit und Offenheit, die Gastorchester zum Beispiel dazu verführt, ihre erprobten Stücke in der Elbphilharmonie neu zu entdecken. Der Saal ist ein eigenständiges Instrument, auf den sich die Künstler einlassen müssen, und den man auch spielen und beherrschen lernen muss wie ein Instrument. Wer sich darauf einlässt, kann hervorragende und einzigartige Abende produzieren. Davon haben wir viele erlebt und das ist ein gigantisches Geschenk.
Warum war zum Beispiel das moderne György-Ligeti-Opern-Spektakel „Le Grand Macabre“ so ein Publikumserfolg im Großen Saal? Weil Alan Gilbert hervorragend mit dem Saal gespielt hat und vielleicht auch weil große Teile des Publikums, die eigentlich wegen des Großen Saals gekommen sind, nach dem Konzert herausgekommen sind und auch von der Musik begeistert waren. Die Besucher springen über ihren Schatten, überwinden ihre eigene Erwartungshaltung und stellen fest, dass Musik aus dem 20. Jahrhundert doch nicht so anstrengend ist wie sie vielleicht zuvor gedacht haben. Sie kann genauso bereichernd sein wie eine Beethoven-Symphonie, von der ich weiß, was mich erwartet. Genau das ist das Spannende: dass es uns mit der Elbphilharmonie gelingt, Publikumsgruppen an musikalische Erlebnisse heranzuführen, die sie sonst nicht erlebt hätten. Das wird auch in Zukunft so bleiben und ist der große Erfolg, den die Elbphilharmonie in programmatischer und sogar musikpädagogischer Hinsicht hat.
Und die Fans moderner Musik fühlen sich in ihrem elitären Tempel gestört. Letzten Endes nicht: Natürlich besteht die Gefahr, dass der eine oder die andere aus einem bildungsbürgerlichen Dünkel heraus sagen könnte, dass da die vermeintlich Falschen im Saal sind. Für mich sind da aber genau die Richtigen im Saal. Wir wollen das Publikum, das wir mit dem Konzerthaus ansprechen, ja verbreitern. Die klassische Musik hat als Kunstform nichts davon, wenn sie sich darauf ausruht, dass es in bestimmten Segmenten unserer Gesellschaft einfach dazu gehört, ins Konzert zu gehen. Die klassische Musik hat dann Zukunft, wenn wir es schaffen, die Begeisterung für die herausragende Qualität der Musik dauerhaft auch in neuen Zielgruppen zu wecken und zu sichern. Und dafür ist die Elbphilharmonie ein herausragendes Instrument.

aus Alabama. Nach meinem Highschool-Jahr in Texas habe ich mir ein Herz für die Countrymusik bewahrt.“ Foto: Thomas Hampel
Welche Musik mögen Sie und was hören Sie im Auto oder zu Hause? Ich höre fast alles. Im Auto schätze ich Countrysongs von Townes Van Zandt oder Guy Clark aus Texas oder Jason Isbell aus Alabama. Beim Fahren würde ich nie ein Sinfoniekonzert hören. Ich habe mir nach meinem Highschool-Jahr in Texas ein Herz für die Countrymusik bewahrt und lege manchmal mit Rainer Moritz, dem Leiter des Literaturhauses Hamburg am Schwanenwik, Musik auf. Da geht es nicht um die typische Trucker-Countrymusic, sondern um große und tiefe Songkunst. Ich mag darüber hinaus, wenn sich verschiedene Musiktraditionen begegnen, wie zum Beispiel in der Melange eines Tony Joe White, in der sich die schwarze Blues- und Soultradition mit der weißen Folk- und Countrytradition mischt. Manchmal drücke ich bei meinem 120 Gigabyte-iPod auch einfach auf „Shuffle“ und lasse mich überraschen. Meine zwei Töchter finden das nicht so cool, aber die haben im Auto ja Kopfhörer und können ihre eigenen Sachen hören.
Den Kontrapunkt zur Elbphilharmonie bildet das raue Oberhafenquartier mit moderner Musik und Ausstellungen in der Halle 424 und anderen Kunst- und Kulturevents. Hat der Oberhafen eine Bedeutung für Hamburg? Auf jeden Fall. So eine kulturelle, eigenständige Zwischennutzung in unfassbar zentraler Lage für die kommenden zehn Jahre zu ermöglichen, ist für eine Stadt keineswegs selbstverständlich. Den Raum hätte man auch immobilienwirtschaftlich optimiert für Büros und anderes nutzen können. Es ist ein Signal Hamburgs, diese krausen Ecken, diese kreativen Bruchkanten der Stadt, nicht nur zu erhalten, sondern sich darum zu kümmern und sie auf Dauer weiterzuentwickeln.
Warum ist das wichtig? Gerade in einer Stadt wie Hamburg, die rasant wächst und sich nach innen verdichtet, müssen wir die Orte, an denen Kultur eigenwüchsig entsteht, schützen und behutsam weiterentwickeln. Da machen die HafenCity Hamburg GmbH und die Hamburg Kreativ Gesellschaft gemeinsam einen guten Job. Die Halle 424 mit ihren Musikveranstaltungen und Ausstellungen, die Hanseatische Materialverwaltung oder die Galerien, Kreativbüros und Filmstudios – das alles zusammen ist schon richtig toll. Schon heute wirkt es auf mich jedes Mal lebendiger, wenn ich wiederkomme. Und wenn dann auf der anderen Seite noch Hammerbrooklyn und im Lohsepark der Gruner+Jahr-Verlag dazu kommt, entsteht dort ein hochspannender Ort. Im Moment liegt das Quartier gefühlt am Rande der HafenCity, aber das bleibt ja nicht so. Der Oberhafen wird eine Scharnierstelle zwischen der schon entwickelten westlichen HafenCity mit überwiegender Büro- und öffentlichen Nutzung und dem gerade entstehenden östlichen Teil mit Wohnbebauung. Schon in wenigen Jahren wird man den Oberhafen als Zentrum wahrnehmen.
Wie jüngst bei der Eröffnung des Virtual-Reality-Festivals Vrham! bleiben Sie länger und halten nicht nur eine Eröffnungsrede. Warum? Ich interessiere mich glücklicherweise für die Dinge, um die ich mich kümmern darf. Leider ist der Terminkalender so eng getaktet, dass das viel zu selten geht. Wann immer es möglich ist, versuche ich das. Das Spannende an meinem Amt ist das, was ich vor Ort erfahre, erlebe und an neuen Eindrücken aufsaugen kann. Ich kann mir jedenfalls keinen inspirierenderen Job als den des Kultursenators vorstellen, weil man permanent mit neuen Blickwinkeln auf die eigene Existenz, das eigene Leben, die eigene Welt und die Gesellschaft konfrontiert wird. Und man die einmalige Chance hat, sich das anzuschauen, mit kreativen und klugen Menschen darüber zu sprechen – und selbst angeregt zu werden!
Alle finden Hamburg schön und kulturell etwas langweilig im Vergleich zum wilden Berlin mit seinen Clubs. Warum? Da widerspreche ich. Wir haben zum Beispiel auf St. Pauli mit seiner Livemusik-Landschaft eine einzigartige Szene, die in Deutschland ihresgleichen sucht – selbst in anderen Metropolen gibt es das nicht in der Dichte und der Qualität. Hamburg hat eine unglaubliche innere Vielfalt und deswegen extreme Kontraste.
»Vom Schanzenviertel aus bin ich mit dem Fahrrad in zehn Minuten
Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien
in Harvestehude. Dabei wechsle ich in ein komplett anderes soziales und kulturelles Ökosystem. Beides ist Hamburg, beides prägt Hamburg. «
Zum Beispiel? Vom Schanzenviertel aus bin ich mit dem Fahrrad in zehn Minuten in Harvestehude. Dabei wechsle ich nicht nur den Stadtteil, sondern in ein komplett anderes soziales und kulturelles Ökosystem. Beides ist Hamburg, beides prägt Hamburg. Diese innere Vielfalt und Heterogenität müssen wir als eine Stärke unserer Stadt begreifen. Aus dieser Vielfalt entstehen Spannungen und Konflikte, mit denen wir kreativ umgehen müssen. Mir ist das viel lieber, als wenn sich das alles auf einem mittleren Niveau mischen und irgendwie nivellieren würde. Gerade die Kontraste – wie zum Beispiel die zwischen Elbe und Alster, zwischen weißen Alstervillen und roten Backsteinbauten im Osten – machen die innere Kraft der Stadt aus.
Verändert die Digitalisierung diese gelernte Balance oder die Gegensätze von Kulturunterschieden? Im Silicon Valley gibt es den nüchternen Satz „Alles, was ein Computer machen kann, wird er künftig machen.“ Wir beschäftigen uns manchmal sehr intensiv in Deutschland mit der Frage, ob wir die Digitalisierung brauchen. Und übersehen dabei, dass sie in vollem Gange ist. Das fing an mit der Kommunikation, ging dann weiter mit der Produktion und Logistikprozessen in der Fertigung und der Industrie. Mittlerweile sind wir im Prozess der kompletten Durchdringung des öffentlichen Raums mit digitalen Schnittstellen. Vor drei Jahren habe ich auf einem Kongress den Satz gehört, es gäbe inzwischen mehr Geräte auf der Welt, die online seien, als Zahnbürsten. Das war keine Kritik an der Zahnhygiene der Menschheit, sondern ein Hinweis darauf, wie weit die Digitalisierung schon fortgeschritten ist. Es wird künftig jedes Gerät, das am Strom ist, vernetzt und online sein. Die Herausforderung für uns als Stadt ist, dazu beizutragen, dass diese Systeme so gebaut werden, dass sich sowohl im Hinblick auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger Hamburgs als auch auf unsere Innovations- und Wirtschaftskraft eine Chance für ein besseres Hamburg bietet.
Warum ist das wirtschaftlich wichtig? Weil wir zurzeit häufig wirtschaftlich erfolgreich in analogen Märkten sind. Gerade diese erfolgreichen Unternehmen kommen bei gravierenden Marktveränderungen oftmals in Schwierigkeiten. Das müssen wir zügig und sorgsam weiter in den verschiedenen Branchen aufarbeiten und entwickeln. Und für den Bereich der Kultur bietet es ungeheure Möglichkeiten, zum Beispiel für die künstlerischen Ausdrucksweisen, wie auf dem Festival Vrham! im Oberhafen zu sehen war.
Da regiert die Virtual-Reality-Brille in Echtzeit an verschiedenen Orten auf dem Globus, während wir hier wie in der Steinzeit mit einem Tonband als Backup sitzen und analog in Ihrem Büro miteinander reden. Warum? Weil wir Menschen uns zum Glück von Zeit zu Zeit noch mal ganz gerne treffen wollen. Spannenderweise entstehen ja auch Start-ups nicht, weil jemand in Schottland mit seinem Kollegen in Griechenland über Social Media kommuniziert, sondern eher auf einem Weihnachtsmarkt in Ottensen oder der HafenCity, wenn Menschen ganz real zusammen sind. Und die menschliche Begegnung wird in dem Moment wichtiger, in dem wir die Welt virtualisieren. Das sehen Sie an der Musikbranche. Das Liveerlebnis ist in Zeiten der Digitalisierung wieder wichtiger geworden. Pathetisch gesprochen: Sie wollen, dass der Schweiß des Sängers Ihnen in der ersten Reihe auf die Stirn tropft. Das gehört mehr denn je zur physischen und haptischen Realität dazu.
Also ein Widerspruch zur Digitalisierung? Eher die Kehrseite von Vernetzung und Digitalisierung. Auch hier Kontraste miteinander zu erleben, ist spannend. Das Live-Theatererlebnis beispielsweise nimmt in seiner Bedeutung für die Besucher durch neue virtuelle Erlebnisformen nicht ab. Wenn ich in einem Raum mit tausend anderen Leuten sitze und es stehen echte Menschen auf der Bühne, die mit wahrnehmbarer Konzentration, Anstrengung und auch mit Fehlern spielen, hat das eine eigene Aura. Diese besondere Art von Aura wird immer stärker an Bedeutung gewinnen, weshalb mir um Kunst und Kultur in der digitalen Welt nicht bange ist. Ich bin gegen den allgemeinen kulturkritischen Skeptizismus, den wir manchmal haben. Ganz im Gegenteil: Die Kultureinrichtungen haben durch Vernetzung und Digitalisierung die Möglichkeit, mehr über ihre Besucher zu wissen und ihnen passgenaue Angebote zu machen, sie besser zu informieren und an Leute heran zu kommen, die sie bislang nicht erreichen konnten, weil diese es nicht als relevant erachtet haben, in ein Museum oder Theater zu gehen.

an Fenstern und Balkonen, sondern an Geschäften, Galerien und Cafés in den Erdgeschossen vorbeilaufe. Da entsteht eine urbane Qualität, die eine Stadt lebenswerter
macht. Amerikanische Stadtsoziologen sprechen heute von einer „walkable city“, in der man innerhalb einer Meile alles erreichen kann, was man braucht.“ Foto: Thomas Hampel
Wenn Gruner + Jahr 2021 mit seinem Verlag in den Lohsepark zieht, müssen sie auch größere öffentliche Flächen für Kunst und Kultur zur Verfügung stellen. Was ist die Idee an dieser Private-Public-Partnership? Das setzt Prof. Bruns-Berentelg, Leiter der HafenCity Hamburg GmbH, an mehreren Standorten um. Heute sind Stadtteile interessant, in denen wir keine homogene Büro-, Einzelhandel- oder Wohnnutzung haben, sondern eine unterschiedliche Durchmischung und Nutzung von Stadt, gerade dort, wo in den Erdgeschossflächen begehbare öffentliche Räume sind. Das geht auch mir so. Ich fühle mich in Vierteln wohler, in denen ich nicht nur an Fenstern und Balkonen, sondern an Geschäften, Galerien und Cafés in den Erdgeschossen vorbeilaufe. Da entsteht eine urbane Qualität, die eine Stadt lebenswerter macht. Amerikanische Stadtsoziologen sprechen heute von einer „walkable city“, in der man innerhalb einer Meile alles erreichen kann, was man braucht. Und dazu gehören eben auch, um wieder auf Gruner + Jahr zurückzukommen, Flächen für Kultur. Gegenüber im Lohsepark haben wir das gleiche Prinzip: Im Erdgeschoss werden wir mit dem gerade entstehenden Dokumentationszentrum zum Gedenkort Hannoverscher Bahnhof eine öffentliche Nutzung haben. Häuser sollen sich für die Menschen öffnen, dadurch werden wir eine andere Durchmischung von öffentlichem und gebautem Raum in der Stadt haben. Das wird die urbanen Stadträume aufwerten.
Auf dem Grasbrook gegenüber der HafenCity wird das Deutsche Hafenmuseum entstehen mit der dann restaurierten Hamburger Viermastbark „Peking“ . Kritiker wie Architekt Volkwin Marg von gmp hätten es gerne auf dem Gelände vom Schuppen 50 am Hansahafen mit direktem Kontakt zum Hafen und der Stadt gehabt. Ist der Grasbrook-Standort zu museal? Der Standort bei den 50er Schuppen hätte eine hohe Plausibilität gehabt, war aber wegen benachbarter Störfallbetriebe genehmigungsrechtlich nicht möglich. Das haben wir ein Jahr lang sehr gründlich prüfen lassen. Der jetzige Beschluss sieht vor, das heutige Hafenmuseum an den 50er Schuppen, dem historisch-authentischen Ort, so zu sanieren, wie es die Genehmigungslage erlaubt. Gleichzeitig wird das künftige Deutsche Hafenmuseum als Teil der Stadtentwicklung auf dem Grasbrook neu gebaut. Ich finde, dass es ein schönes Signal ist, dass Kulturräume zur Stadtentwicklung dazu gehören. Und das Museum, eine kulturelle Nutzung, wird das erste beschlossene Projekt auf dem Grasbrook sein. Das zeigt, welche stimulierende Kraft die Kultur haben kann. Ich glaube, dass es mit den zwei Standorten sehr gut werden wird, zumal man die beiden Standorte mit einem Barkassenshuttle verbinden und künftig so ein echtes Hafenerlebnis im Rahmen des Museumsbesuchs ermöglichen kann.
Elbphilharmonie-Förderer: „Natürlich besteht die Gefahr, dass der eine oder die andere aus einem bildungsbürgerlichen Dünkel heraus sagen könnte, dass da die vermeintlich Falschen im Saal sind. Für mich sind da aber genau die Richtigen im Saal. Wir wollen das Publikum, das wir mit dem Konzerthaus ansprechen, ja verbreitern.“
Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien
Nun gibt ja zum Glück noch ein reiches Kulturleben außerhalb des Hafens und der HafenCity. Im September beginnen nach der Sommerpause u.a. die zwei großen Bühnen, das Thalia Theater und das Schauspielhaus, mit ihren neuen Spielplänen. Was erwarten Sie von den Dramentempeln? Beiden Häusern gelingt es immer gut, uns zu überraschen. Die Spielpläne in beiden Häusern sind spannend. Interessant wird am Thalia Theater sicher die Neuinszenierung des Stücks „Liliom“, das in Hamburg unter dem damaligen Intendanten Ulrich Khuon schon mal Theatergeschichte geschrieben hat, als der frühere Erste Bürgermeister Klaus von Dohnanyi sich empört über die Inszenierung äußerte. Außerdem starten Intendant Joachim Lux und das Thalia Theater ihr Projekt, mit zwei eigenen internationalen Koproduktionen und Gastspielen verstärkt andere Theaterfarben aus Europa in Hamburg erfahrbar zu machen. Robert Wilson kommt mit seiner Inszenierung „Mary said what she said“ und Isabelle Huppert in der Titelrolle. Das kann sehr interessant werden. Dass das Schauspielhaus mit Michel Houellebecqs aktuellem „Serotonin“-Stoff in die Saison startet, ist eine spannende Ansage. Und „Die Nibelungen – allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie“ von Barbara Bürk und Clemens Sienknecht wird sicher ein humoriger Abend. Die beiden Häuser entwickeln sich komplementär zueinander und haben jeweils ihre eigene Färbung. An beiden Häusern machen Ensembles und Regisseure einen tollen Job.
War früher mehr Feuer unterm Dach im Wettbewerb zwischen der Sprechtheaterbühne Thalia und dem Zadekschen Krawall-Schauspielhaus für junge Theaterbesucher? Heute gibt es an allen Häusern in Hamburg einen großen Formenreichtum. Sicher gibt es bestimmte Traditionen, die sich aus den Ensembles und den Kernregisseuren ergeben, aber das wird inzwischen deutlich bunter. Der diesjährige Spielzeitauftakt an der Staatsoper mit Schostakowitschs „Die Nase“ wird von der Schauspielhaus-Intendantin Karin Beier inszeniert – das zeigt, dass man über die Grenzen von Institutionen hinweg zusammenarbeiten kann. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
War das Theater in den 70er und 80er Jahren in Hamburg mit den Intendanten-Gurus von Thalias Jürgen Flimm und Peter Zadeks Schauspielhaus wettbewerblicher und anarchischer? Das glaube ich nicht. Bühnen reflektieren, nehmen auf und entwickeln weiter, was in Gesellschaften passiert. Gerade die Bühnen bieten zurzeit einen spannenden Diskurs darüber, wie man mit den Tumulten in unserer Gesellschaft aktuell umgeht. Theater ist für mich heute nach wie vor der Ort, an dem ich zum Beginn einer Vorstellung wahrscheinlich am wenigsten darüber weiß, was mich in den nächsten zwei bis drei Stunden erwartet. Allein das ist schon ein wichtiges anarchisches Moment in unserer Gesellschaft, die eher mit Erwartungssicherheiten arbeitet.
Hamburgs Kulturimage strahlt jenseits der Elbphilharmonie nicht so wie in Berlin oder München. Was haben die, was wir nicht haben? Berlin und München haben eines nicht: Sie reflektieren weniger darüber, was andere Städte haben könnten, was sie selber nicht haben.
Viele hielten die Schuhe Ihrer Vorgängerin Barbara Kisseler für zu groß. Wie sehen Sie es nach zwei Jahren erfolgreicher Arbeit? Das müssen andere entscheiden. Mir macht es jedenfalls großen Spaß und in der Kulturlandschaft der Stadt bewegt sich etwas.
Als Sie angetreten sind, haben Sie eine „Renaissance der Kulturpolitik“ ausgerufen. Wo ist das für Sie bislang am nachhaltigsten passiert? In der allgemeinen politischen Debatte. Wir haben viel stärker noch als vor zehn Jahren Themen, die unmittelbar mit Kultur zu tun haben, auf der politischen Agenda. Wir reden nicht mehr nur über den sozialen Zusammenhalt und darüber, ob wir eine Spaltung der Gesellschaft überwinden müssen, die sich sozial manifestiert. Sondern wir reden immer mehr auch über die Frage, was den Sinn und den inneren Zusammenhang einer Gesellschaft ausmacht. Das sind genuine Kulturfragen. Wir müssen uns ihnen stellen, um nicht den Rechtspopulisten das Feld zu überlassen, die fälschlicherweise fordern, dass unsere Gesellschaft sich wieder fokussieren müsse auf eine Homogenität, die nicht der Realität in unserem Land entspricht und die ich auch für langweilig, stumpf und am Ende gefährlich halte.
Was bedeutet das für die Kulturpolitik? Wir stehen vor der wachsenden Aufgabe, wie wir aus der wahrgenommenen Vielfalt unserer Gesellschaft den Sinn eines Gemeinsamen destillieren können. Mit diesen Fragen müssen wir uns auseinandersetzen, es sind relevante politische Fragen geworden. Wir sprechen nicht mehr aus der Perspektive des Stadtmarketings darüber, dass wir Kultur brauchen, um die Stadt für Fachkräfte attraktiv zu machen. Sondern wir reden über Kultur als einen Raum, in dem die Gesellschaft mit sich selber verhandelt, wie sie sich eigentlich sieht. Und in dieser Debatte stecken wir mittendrin.
Wir haben vorhin vor dem „Schlacke“-Bild von Gerd Stange ein Foto gemacht. Sie kommen aus der Schalke-04-Tiefebene Gelsenkirchen und wirken vom Typ her eher understatementmäßig. Wie passt das rußige und laute Ruhrgebiet zu Ihrer Persönlichkeit? (lacht) Das sage ich Ihnen dann, wenn mit meinem Namen nicht mehr das Etikett „senatorabel“ verknüpft wird.
Sie können also schon ein Bier trinken? Unfallfrei. Und ich kann sogar zapfen und weiß, was der Satz bedeutet, dass ein gutes Pils sieben Minuten braucht, damit die Blume richtig aussieht.
Wie entspannen Sie? Schlafen Sie abends im Bett mit Buch, Musik oder Tablet ein? Ohne die drei Dinge. Zum Entspannen höre ich viel Musik und versuche viel zu lesen, was nach einem Tag, an dem man schon viele Akten und Drucksachen gelesen hat, nicht in dem Ausmaß gelingt, wie ich es gerne machen würde. Wunderbar entspanne ich beim Schauen von Politikserien im Fernsehen. Es gibt keine US-amerikanische Präsidenten-Serie, die ich nicht geguckt hätte. Meine Lieblingsserie aus dem Politikbereich ist „The West Wing – Im Zentrum der Macht“.
Und welcher Film hat Sie zuletzt berührt? Das war der isländische Eröffnungsfilm „Gegen den Strom“ beim letztjährigen Filmfest Hamburg, den ich unglaublich faszinierend fand.
Hand aufs Herz. Auf welches Kulturereignis der kommenden Monate freuen Sie sich am meisten? Auf die Publikation des neuen zweibändigen Werks von Jürgen Habermas, „Auch eine Geschichte der Philosophie“, mit 1.700 Seiten im Suhrkamp-Verlag.
Und wie verstehen Sie den berühmten Satz von Theodor W. Adorno, wie Habermas auch Frankfurter Schule, dass es „kein richtiges Leben im falschen“ gäbe? Wichtig ist, was Adorno damit meinte: dass man keine Biedermeiermöbel in die Bauhaus-Architektur des Hansaviertels in Berlin stellen sollte. Der Satz wurde nur immer anders verwendet. Richtig daran ist, dass man es sich nicht im Kleinen gemütlich machen sollte, wenn es draußen schwierig wird. Es gilt immer, das Ganze im Blick zu behalten. Das gilt auch für die Hamburger, die es sich manchmal im Kleinen gemütlich machen, weil sie glauben, hier sei die Welt noch mehr in Ordnung als woanders. Und gerade weil das vielleicht so ist, haben wir eine Verantwortung für das, was wir hier richtig machen, an anderer Stelle zu kämpfen, so dass es sich dort auch durchsetzt.
Wie finden Sie die Hollywood-Maxime „Bigger Than Life“? Ich kann der nicht so wahnsinnig viel abgewinnen, weil sie leicht großmannssüchtig wirkt. Es ist aber hilfreich, ein realistisches Gefühl für die eigene Größe und die eigene Kraft zu entwickeln.
Gerade ist Ihr Buch „Die Zerstörung – Warum wir für den gesellschaftlichen Zusammenhang streiten müssen“ im Hoffmann und Campe Verlag erschienen. Warum haben Sie es geschrieben? Das Buch ist ein Essay zur aktuellen politischen und gesellschaftlichen Lage, die spätestens seit der Europawahl und dem Video „Die Zerstörung der CDU“ des YouTubers Rezo deutlich sichtbar geworden ist. Die Fragen, wie es um unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt steht und wie wir in der Politik darauf reagieren können, damit dieser nicht noch weiter erodiert, treiben mich schon länger um.
Was kann ein Buch und auch Ihr Buch erreichen, das der Senator für Kultur und Medien nicht schaffen kann? In dem Buch beschäftige ich mich mit Themen, die weniger mit Kulturpolitik zu tun haben, als vielmehr mit der Frage nach den Möglichkeiten einer leidenschaftlich vernünftigen Politik in einer offenen Gesellschaft. Insofern stellt sich die Frage so nicht. In Hamburg bekommen wir das ganz ordentlich hin – aber wir müssen Fragen des Zusammenhalts und des Fortschritts und der Zuversicht insgesamt wieder stärker ins Zentrum demokratischer Politik rücken.
Das Gespräch führte Wolfgang Timpe