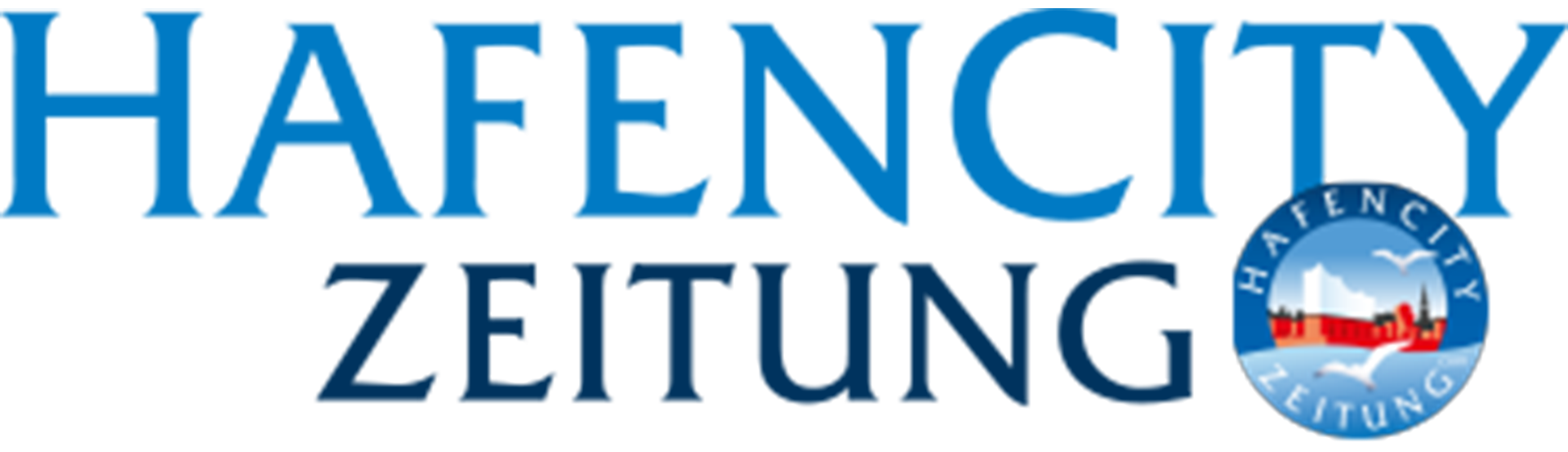Foto oben: Die Stadt, der Hafen und die Elbe liegen ihm zu Füßen. Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant der Elbphilharmonie in seinem Büro im 10. Stock der Elbphilharmonie. Foto: Thomas Hampel
Elbphilharmonie-Chef Christoph Lieben-Seutter im Gespräch mit HafenCity-Redakteur Wolfgang Timpe über Frauen am Pult, Anarchie in der Klassik und die Nachbarschaft mit der HafenCity
Herr Lieben-Seutter, wir sitzen hier in Ihrem Büro im 10. Stock der Elbphilharmonie und wir sind umgeben von Elbe und Hafen, den Landungsbrücken und der HafenCity. Wie finden Sie den jüngsten und schnell wachsenden Stadtteil Hamburgs? Immer schon spannend. Einer der Gründe, warum ich 2007 von Wien nach Hamburg gekommen bin, war der Ort. Nicht nur die Aufgabe, ein neues Konzerthaus von der Geburt an zu begleiten, sondern auch die Bedeutung des Standorts mit seiner ganzen Dynamik hier an der Spitze der HafenCity. Dass hier nicht nur ein neues Gebäude, sondern ein ganzer Stadtteil neu entstehen würde.

Foto: Thomas Hampel
Reizte Sie das Zukunftsgefühl einer wachsenden Stadt? Durchaus. Ich mag Veränderung und städtische Infrastrukturen und beobachte gerne, wie die Welt sich verändert.
Was fasziniert und was stört Sie an der HafenCity? Im Großen und Ganzen finde ich die HafenCity gelungen. Mich faszinieren besonders die Schnittstellen zur Vergangenheit, etwa wo alte Lagerschuppen mit Schienen standen, auch die aktuellen Nutzungen in den Hallen im Oberhafen. Das ist toll, Orte und Gebäude immer wieder neu zu nutzen. Zu befürchten ist, dass mit dem Wachsen des Stadtteils solche Orte und Veranstaltungen wieder stromlinienförmiger werden. In der HafenCity wird halt gewohnt, gearbeitet, gekauft und unterhalten. Doch gerade diese undefinierten Zwischenbereiche finde ich faszinierend. Hoffentlich kann davon etwas erhalten bleiben. Hier direkt an der Elbphilharmonie fehlt mir ein wenig die Großzügigkeit. Der Vorplatz müsste doppelt so groß und die Bebauung am Kaiserkai nicht so kleinteilig sein. Da fehlte noch ein wenig der Mut, der dann in späteren Bauten in der HafenCity durchaus anzutreffen ist.
Verlassen Sie manchmal das Haus und sind in der HafenCity unterwegs? Ja, klar. Die HafenCity ist mein Arbeitsort und die Gastronomieszene kenne ich recht gut. Mittlerweile ist das Mittagsangebot rund um die Elbphilharmonie reichhaltig und auch abends, wenn man zum Beispiel mit Künstlern unterwegs ist, habe ich einige Lieblingsorte wie das Kinfelts am Kaiserkai oder Strauchs Falco am Magdeburger Hafen, wo kulinarisch etwas geboten wird. Da ich Einkaufen nicht mag, kann ich zu dem diesbezüglichen Angebot leider nichts sagen (lacht).

Dirigentenpult. In Orchestern haben Frauen ja schon großenteils durchgesetzt, außer in meiner Heimatstadt.“ Foto: Thomas Hampel
Manche Gewerbetreibende oder Anwohner sagen: Die Elbphilharmonie ist prima, aber ein eigener Kosmos, der wie ein UFO für sich funktioniert. Könnte die Elbphilharmonie auch in der Südsee oder auf dem Mond erfolgreich sein? Definitiv nein. Die Elbphilharmonie kann an keinem anderen Ort stehen. Die Faszination des Gebäudes ergibt sich aus der grundsätzlichen architektonischen Idee, auf dem Kaispeicher ein Konzerthaus zu bauen. Und der Kaispeicher ist nun einmal hier und nicht in der Südsee. Und der Ort ist für Hamburg symbolbeladen – mitten in der Elbe, an drei Seiten Wasser mit dem Hafen und der Stadt direkt davor. Das ist an keinem anderen Ort der Welt denkbar. Im Nachhinein betrachtet war die städtebauliche Entwicklung des Hauses tatsächlich zu isoliert, da hat man anfangs nicht wirklich großzügig und übergreifend gedacht. Zwischen den damaligen Verantwortlichen für die Elbphilharmonie und die HafenCity gab es kaum Austausch. Das merkt man an dem fehlenden Vorfeld, der eingeschränkten Zugänglichkeit über die Mahatma-Gandhi-Brücke oder dem abends abgesperrten Kaiserkai. Die Verbindung zwischen Elbphilharmonie und HafenCity ist nicht optimal gelungen. Allerdings hat damals auch niemand damit gerechnet, dass die Elbphilharmonie so eine starke Anziehungskraft ausüben würde. Es besuchen sie ja heute drei Mal so viel Menschen als seinerzeit geplant wurde.
Was sind die HafenCity und die Elbphilharmonie für ein Pärchen? Vor allem eine gute Nachbarschaft. Wir sind froh, Teil der HafenCity zu sein, und ich bin davon überzeugt, dass die, die hier wohnen, sich freuen, dass es die Elbphilharmonie gibt. Auch die, die unter der Verkehrsbelastung leiden, müssen zugeben, dass die HafenCity ohne Elbphilharmonie kein so spannender Ort wäre. Deswegen gute Nachbarschaft, beide haben etwas davon.
Braucht Hamburg die Elbphilharmonie oder die Elbphilharmonie auch Hamburg? Die Elbphilharmonie ist für Hamburg da. Sie ist in Hamburg entstanden und sie ist das neue Wahrzeichen der Stadt. Eine Kulturinstitution von Weltrang erhält ihre Glaubwürdigkeit von der Verankerung in der Bevölkerung. Die Elbphilharmonie muss vom Hamburger Publikum frequentiert, geliebt und kritisiert werden, sonst wäre sie nur eine Touristenattraktion wie der Eiffelturm, wo die Besucher einfach nur rauf und wieder runter laufen, ohne sich für das Programm zu interessieren. Der allergrößte Teil der Konzertbesucher kommt aus Hamburg und der Metropolregion.
Wie leben Sie in Hamburg, urban oder im Grünen? Wir leben mit der Familie und unserem Tibet-Terrier urban im Grünen, mitten in der Stadt und nahe der Alster. Ich liebe es, ins Grüne und aufs Wasser zu schauen.
Gerade feierten Kritiker die wilde Inszenierung der Oper „Le Grand Macabre“ von György Ligeti, dirigiert von Alan Gilbert, designierter Chef des NDR Elbphilharmonie Orchesters, als „Apokalypse wow!“ und „Meilenstein des modernen Musiktheaters“. Wie kommen Sie dazu, im Großen Saal die opernhafte Anarchie auszurufen? Ach, dazu ist Kunst doch da. Sie kann und sollte immanent subversiv sein. In einem Kunstwerk ist es angelegt, auch in der klassischen Musik, dass sie aufbegehrt, polemisiert, Fragen stellt und aufklärt. Und so ist es selbstverständlich, dass es Werke gibt, die zu kontroversen Diskussionen führen.
Hat deswegen die szenische Oper „Le Grand Macabre“ im Großen Saal funktioniert? Üblicherweise machen wir keine szenischen Opern. Wir sind ein Konzerthaus, weshalb es vorrangig Musik oder auch mal Opern im Konzert zu hören gibt – ohne Bühnenbild und Kostüme. Hier und da leisten wir uns den Luxus und sperren den Großen Saal ein paar Tage für Proben einer Produktion, in der theatralische Elemente eine Rolle spielen. Zuletzt war es die „Fledermaus“ zu Silvester oder jetzt „Le Grand Macabre“, übrigens beides in Koproduktion mit dem NDR. Einerseits ist es Klamauk, andererseits eine tolle Musik. Das ist ja das Wunderbare an der Kunst und der Musik, die ich so liebe, dass sie so viele verschiedene Ebenen hat. Ein Konzert kann beruhigen und unterhalten, kann verstören, zum Denken anregen oder einfach ein Genuss für Kenner wie für Nichtkenner sein. Eine gute Aufführung hat viele verschiedene Ebenen. Und so war das auch bei „Le Grand Macabre“.

Wenn man sie nur als gemütliche, einlullende Abendunterhaltung in einem musealen Ambiente präsentiert, nimmt man ihr das Potenzial.“ Foto: Thomas Hampel
Haben Sie mit diesem positiven Echo gerechnet und waren Sie vorher aufgeregt? Jeden Abend bin ich angespannt, ob alles gut funktioniert. Wobei „Le Grand Macabre“ für unsere Verhältnisse extrem komplex war. Nicht nur weil Orchester, Sänger und Chor auf der Bühne stehen, sondern zusätzlich alle Theatergewerke wie Bühnenbild, Kostüme, Maske, Licht, eine große Videoprojektion, Radiomitschnitt und ein Livestream fürs Internet stattfanden. Wir haben sonst nicht so viele Ebenen zu beachten. Da kam das Team ordentlich unter Druck. Und dass es dann so prima funktioniert hat, macht uns stolz auf das Team und unser Haus.
Apropos Livestream. Das Digitale gehört für Sie zur klassischen Musik inzwischen dazu? Das hat sich schon vor zehn Jahren abgezeichnet. Früher nahm diesen Platz das Radio ein, und die große Fernsehproduktion war die Ausnahme. Heute ist es durch die digitale Technik weit weniger aufwändig, so dass wir etwa zwanzigmal im Jahr Konzerte live streamen und dafür auch die Technik mit ferngesteuerten Kameras, Regieraum und den erforderlichen Datenleitungen selbst im Haus haben.
Zählt für Sie persönlich als Musikliebhaber nur das Liveerlebnis? Ja, das ist doch mit allen Dingen so. Eine Postkarte von den Pyramiden ist auch schön, aber es ist längst nicht dasselbe, wie vor der Cheops-Pyramide zu stehen. Nichts ersetzt das Gefühl, mit 2.000 anderen Menschen in einem Saal zu sitzen und gemeinsam etwas zu erleben. Der Moment, der auf der Bühne passiert, ist kein abspielbarer, wiederholbarer Waschmaschinengang. Obwohl in der klassischen Musik klar ist, welche Noten gespielt werden, ist jeder Abend anders: Wie die Musik erklingt und mit welchem Einsatz, in welchem Zusammenspiel und mit welcher Inspiration, entscheidet sich jeden Abend neu. Auch durch die Interaktion zwischen Bühne und Publikum. Und das ist durch nichts zu ersetzen.
Und wie erklären sich das Enthusiastische des Erfolgs? Es war einfach szenisch und musikalisch sehr gut. Den Anspruch haben wir jeden Abend. Und was mich generell freut: Wir bringen in der Elbphilharmonie recht häufig Musik aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder solche, die erst vor kurzem entstanden ist, das gilt gemeinhin als Kassengift. Schließlich wollen angeblich alle Konzertgänger Mozart und Brahms hören. So geht die Musikgeschichte aber nicht. Mozart und Brahms sind unerreicht, und trotzdem geht die Musikgeschichte weiter. Und es werden weiter unglaubliche Meisterwerke komponiert, die weder nachpfeifbare Melodien noch einen Dreivierteltakt haben und die dennoch viele Eindrücke schaffen und die Fantasie anregen, unsere Welt spiegeln, manchmal auch extrem dissonant und verstörend sein können. Diese Werke kommen in anderen Konzerthäusern oft zu kurz. Erstens muss man immer für die beste Qualität sorgen, und zweitens macht es auch nur in einem vollen Saal wirklich Spaß. Und in der Elbphilharmonie kommt diese Musik besonders gut an. Weil wir einerseits gut besucht sind, andererseits suggeriert das Gebäude: Achtung, hier passiert etwas Unerwartetes, Neues und Abenteuerliches. In der Elbphilharmonie ist das Publikum viel eher bereit, sich auf eine Musik einzulassen, die es noch nicht kennt, als zum Beispiel in der Laeiszhalle, die so sehr Brahms ausstrahlt.
Braucht es, auch als erfahrener Intendant, solche Erfolge, um mutige Programme erst zu denken und dann zu realisieren? Brauchen auch Sie Zustimmung? Natürlich brauche ich Zustimmung, jedoch nicht, um mutige Programme zu denken. Ich bin mit Musik aufgewachsen und interessiere mich für alle Arten von Musik. Ich kenne so viel tolle Musik, die ich dem Publikum gerne nahebringen würde und die nicht automatisch immer auf großes Interesse stößt. Das Programmieren eines Angebots ist immer auch das Einlassen auf die lokale Situation. Was ist das für eine Stadt, was für ein Saal, was für Künstler stehen zur Verfügung und was für ein Publikum kann ich potenziell ansprechen? Es macht keinen Sinn, ein Programm zu machen, auf das niemand reagiert. Ich bin nur froh, wenn der Saal voll ist und am Ende das Publikum begeistert und die Künstler glücklich sind.
Wann sind Sie das erste Mal mit Musik in Berührung gekommen? Bei uns zuhause hat Musik immer schon eine große Rolle gespielt. Auch wenn meine Eltern keine professionellen Musiker waren, gab es von klein auf Kammermusik bei uns und mein Onkel war ein Veranstalter von Musik- und Popkonzerten in Wien. Ich bin mit Klassik und Frank Zappa, Rolling Stones, Ella Fitzgerald oder Oscar Peterson groß geworden. Deren Konzerte im Wiener Konzerthaus haben mich begleitet, und manche Künstler waren bei uns auch Hausgäste. Meine ganze Familie war 1969 im Konzert von Jimi Hendrix, nur ich war noch zu jung. Meine Eltern erzählen, dass ich mit zwei, drei Jahren versucht hätte, Melodien am Klavier zu finden. Musik hat mich immer schon angesprochen.
Gibt es den einen Lieblingskomponisten? Im Laufe des Lebens gibt es eine wechselnde Begeisterung für Musikstile und Künstler, und es gibt Konstanten, die mich begleiten. Es gibt jedoch nicht das eine Werk oder den einen Künstler. Natürlich habe ich als Wiener eine besondere Beziehung zur Musik von Franz Schubert oder zu Alban Berg.
Verkörpert er Ihre moderne Musik-Ader? Nun ja, modern? Zugegeben: Musik von Alban Berg ist nicht ganz tonal, aber sie ist auch schon über 100 Jahre alt. Ich hatte auch immer schon eine Nähe zu schwarzer Musik wie Soul, Funk und Disco, viel eher als zu Heavy Metal (lacht).
Wie komponieren Sie ihre Programme und Musikveranstaltungen? Man muss sich das wie ein Mosaik vorstellen. Es gibt extrem viele Steinchen, die man versucht, zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. Und die sind nicht frei gewählt, sondern ergeben sich aus verschiedensten Umständen – etwa der Terminplanung der Hausorchester, und welche Künstler auf Tournee kommen. Man bespricht Folgeprojekte mit Künstlern, die gerade aufgetreten sind. Man macht sich eine lange Liste von Werken und Themen, die in Hamburg mal gespielt und präsentiert werden müssten. Daran arbeitet man sich über Monate und Jahre ab. So entsteht langsam ein Bild von einer Saison. Und rund sechs Wochen vor Fertigstellung ändert sich nochmal ganz viel.
Sie stehen für abwechslungsreiche Programme aus unterschiedlichsten Musikstilen und Richtungen. Ist das Ihrer elfjährigen Vergangenheit als Chef des Wiener Konzerthauses geschuldet? Eher umgekehrt. Ich wurde bei der Intendantensuche für die Elbphilharmonie gecastet, weil zuvor eine Expertenkommission das Wiener Konzerthaus neben dem Concertgebouw Amsterdam und der Kölner Philharmonie als eines der definierten Vorbilder für die Bespielung der Elbphilharmonie benannt hatte. Man hatte sich an den jeweiligen Programmen in ihrer Breite, Qualität und Zugänglichkeit orientiert. Das Konzerthaus, 1913 eröffnet, war immer schon das Haus, in dem nicht nur klassische Musik geboten wurde. Das andere Haus in Wien, der Musikverein mit dem Goldenen Saal, wo die Wiener Philharmoniker das Neujahrskonzert spielen, war dagegen immer schon eher konservativ.
Inwiefern? Das Wiener Konzerthaus war im gesamten 20. Jahrhundert der Ort, an dem neben Orchestern und Chören auch ein Maurice Chevalier oder ein Miles Davis Konzerte gaben. Und da es bis in die 60er Jahre keine größeren Hallen in Wien gab, musste eben auch Jimi Hendrix da auftreten. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann im Konzerthaus klassische Musik aufgeführt, die im Musikverein nicht gespielt wurde, die zu modern oder von den Nazis verboten gewesen war, wie die von Arnold Schönberg, Igor Strawinsky oder Paul Hindemith. Mit dem Konzerthaus bin ich von Kindesbeinen an aufgewachsen, weil meine Familie dem Haus nahestand.
In der kommenden Spielzeit präsentieren Sie avantgardistische Musik mit Bassblockflötistin Eva Reiter aus Wien und stellen den polnischen Komponisten Mieczyslaw Weinberg, Freund von Dmitri Schostakowitsch, mit eigener Oper vor. Braucht das ruhige Fahrwasser der Klassik den Stachel der Auflehnung, um nicht gepflegte Langeweile zu stiften? Die Klassik ist keineswegs langweilig! (schaut streng). Es gibt nichts Tolleres als die Musik von Johann Sebastian Bach. Und gleichzeitig hört die Klassik nicht mit Anton Bruckner auf. Gerade die Meisterwerke eines Robert Schumann oder Johannes Brahms in Beziehung zu Musik von Igor Strawinsky, Béla Bartók oder einem zeitgenössischen Komponisten zu setzen ist doch viel spannender, als immer nur Brahms zu hören. Die Qualitäten der Alten Meister funkeln so richtig doch erst im Kontext der ganzen Musikgeschichte. Neugier auf und Begeisterung für die verschiedenen Arten von Musik begleitet mich. Ich interessiere mich einfach für Veränderung, im Stadtbild und in der Kunst, und möchte nicht ständig die gleiche Musik und die gleichen Künstler erleben.
Also braucht auch die Klassik künstlerisch den Stachel der Auflehnung? Der Stachel der Auflehnung steckt durchaus in der Klassik. Wenn man sie nur als gemütliche, einlullende Abendunterhaltung in einem musealen Ambiente präsentiert, nimmt man ihr das Potenzial.
Aber Sie können auch Pop. „Roll over Beethoven“ nennen Sie das Jubiläumsprogramm zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven in der kommenden Spielzeit. Was dürfen wir für Lieben-Seutter-Entdeckungen erwarten? Das Programm der Elbphilharmonie wird nicht von mir alleine verantwortet. Ein ganzes Bouquet von Veranstaltern wie das NDR Elbphilharmonie Orchester, das Philharmonische Staatsorchester und das Ensemble Resonanz sowie die Konzertdirektionen Dr. Rudolf Goette oder Karsten Jahnke und viele andere steuern Programm-Elemente bei. Und der größere Teil des Beethoven-Programms wird von der Konzertdirektion Dr. Goette im Rahmen der ProArte-Programme präsentiert. Wir bieten eher kleine Aperçus an, wie zum Beispiel eine Beethoven-Akademie. Das ist ein überlanges Konzert, das Beethoven seinerzeit in Wien auf eigene Kosten selbst veranstaltet hat. Da präsentierte er drei Stunden seiner Musik in einem nicht geheizten Theater. Ein legendäres Konzert, nicht gut aufgeführt, mit viel zu wenig Proben, und trotzdem wegweisend für Beethoven und die Musikgeschichte. Dieses Projekt stellt Thomas Hengelbrock in der Laeiszhalle vor, und wir präsentieren in der Elbphilharmonie ein modernes Gegenstück, wo Werke Beethovens mit Musik der Gegenwart kombiniert werden. Das ist die Beethoven-Akademie 2020.
Was ist Beethoven denn nun: Klassikikone oder Popstar? Beethoven ist mehr als eine Klassik-Ikone. Er ist eine der großen Ikonen der abendländischen Kulturgeschichte und steht auf einer Stufe mit Leonardo da Vinci, Michelangelo oder Pablo Picasso. Beethoven hat die Welt verändert.
Allein im Großen Saal der Elbphilharmonie sind in der Spielzeit 2019/2020 rund 380 Konzerte geplant. Welches Ereignis löst bei Ihnen die größte Vorfreude aus? Das sind viele Konzerte, keine Einzelereignisse. Ich freue mich zum Beispiel auf eine Reihe von Händel-Opern wie das Gastspiel der Mailänder Scala mit „Giulio Cesare“ und einer Allstar-Sängerriege u.a. mit Cecilia Bartoli, Bejun Mehta und Philippe Jaroussky im Großen Saal. Ich bin aber auch sehr gespannt auf total andere Dinge, zum Beispiel auf unser Festival „Ganz Wien“. Es geht da um Musik meiner Heimatstadt abseits der Klassik. Wir präsentieren Künstler aus dem Grenzbereich zwischen Liedermachern, Blues, Electronic, Underground oder Protestsongs. Das ist in Wien eine sehr lebendige Szene, die aber auch sprachlich sehr verwurzelt ist. Die Hamburger haben ja ein Faible für Wien, doch ob dieses Programm verstanden wird oder ob wir Übersetzungshilfe nötig haben werden, wissen wir noch nicht (lacht herzlich).
Ich freue mich besonders auf Mirga Grazinyte-Tyla, die Chedirigentin des City of Birmingham Symphony Orchestra, die im Oktober mit drei Konzerten auftreten wird. Die „New York Times“ und der „Spiegel“ haben sie gerade in den femininen Dirigentenhimmel gehoben. Wie kommen Sie an solche Stars heran? Das ist ganz einfach. Man ruft sie an und lädt sie zu einem Konzert ein. Und wenn man dann auch die Gage bezahlt, die sie wünschen, kommen sie mit großer Wahrscheinlichkeit. Das ist kein Mysterium und Wunder, zumal die Elbphilharmonie eine unglaubliche Zugkraft hat, und wir auch von Künstlern aus allen Bereichen angesprochen werden. Bei Mirga Gražinytė-Tyla kam hinzu, dass ich sie schon als Jurymitglied des Dirigierwettbewerbs der Salzburger Festspiele vor einigen Jahren kennengelernt habe und sie damals ihren Jahrgang gewonnen hatte. Außerdem kenne ich das City of Birmingham Symphony Orchestra seit über 30 Jahren, als Simon Rattle noch Chefdirigent war und ich mit ihnen in Wien jedes Jahr drei Konzerte gemacht habe.
Finden Sie die „Spiegel“-Einordnung als feminine Dirigentin passend? Dirigieren Frauen anders als Männer? Die Körpersprache ist weiblicher, aber das wirkt sich nicht auf das künstlerische Ergebnis aus. Es wird allerhöchste Zeit, dass Frauen an die Macht kommen, auch am Dirigentenpult. In den Orchestern haben sich Frauen ja schon großenteils durchgesetzt, außer in meiner Heimatstadt. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch am Dirigentenpult so sein wird. Das verdoppelt vor allem das Potenzial an tollen Künstler*innen.
Sie haben noch Vertrag bis 2024. Ihre Bilanz als Generalintendant strahlt mit zwei Millionen Konzertgästen, zehn Millionen Plaza-Besuchern und einer annähernden 100-Prozent-Auslastung im Großen Saal. Sind Sie noch hungrig? Durchaus, weil Erfolg gefährlich ist. Er verleitet zum Ausruhen, und wir brauchen das Gegenteil. Wir müssen uns jetzt weiterentwickeln und neu definieren, damit wir für alle Entwicklungen bereit sind, die da kommen werden. Zumal wir auch davon ausgehen müssen, dass die extreme Nachfrage auch einmal etwas nachlassen wird. Der unglaubliche Elbphilharmonie-Hype der Anfangsjahre muss irgendwann abklingen.
Sind für Sie wie im Sport auch im konzertanten klassischen Bereich weltweit Scouting-Teams unterwegs? Nicht weltweit, aber meine Mitarbeiterinnen in der künstlerischen Planung machen schon die eine oder andere Reise. Sie fahren los und schauen sich Künstler, Produktionen und Festivals an. Wobei man sich heute ja schon dank YouTube, Soundcloud und Co. viel schneller ein erstes Bild machen kann. Informationen erhält man durch die Medien ebenso wie von Agenten oder Künstlern selbst und auch durch Kollegen von anderen Konzerthäusern. Das Scouting ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
Welche Veranstaltung oder welcher Künstler war für Sie im Rückblick das ergreifendste und das überraschendste Erlebnis in der Elbphilharmonie? Auch das waren zu viele, um einzelne zu nennen. Generell war überraschend, dass sich die Elbphilharmonie noch toller anfühlt, als wir uns das über die lange Entstehungsphase vorgestellt haben. Und dass der Saal viel mehr Möglichkeiten hat, als wir erwartet haben.
Inwiefern? Der Große Saal ist nicht nur perfekt für die große Sinfonik des 20. Jahrhunderts und die moderne Musik, sondern er kann auch mit barocker Musik und kleinen Chören gut umgehen. Obwohl hier eine ganz andere Akustik als in einer Kirche herrscht, kommt oftmals der sakrale Charakter der Musik im Großen Saal gut zur Geltung. Das spüren die Künstler auf der Bühne wie auch das Publikum.
Am 17. Februar 2020 gastieren die Berliner Philharmoniker unter ihrem neuen, hinreißenden Chefdirigenten Kirill Petrenko. Für Sie Klassik-Starbusiness as usual oder mehr? Das ist deutlich mehr, weil ich Kirill Petrenko bewundere und auch die Entscheidung des Orchesters, sich für Petrenko als Nachfolger von Simon Rattle zu entscheiden, für brillant halte. Er ist ein wirkliches Ausnahmetalent, der auch nicht so im „Business“ mitspielt, wie es eigentlich mit weltweitem Jetset-Dasein und telegener Medien- und Social-Media-Präsenz erwartet wird. Petrenko geht seinen Weg, hat allerhöchste künstlerische Ansprüche und eine unverwechselbare Ausstrahlung.
Apropos Medienpräsenz. Wie haben Sie die Akustikdebatte im Großen Saal erlebt, ausgelöst durch Jonas Kaufmanns Kritik am Klang? Es ist klar, dass es bei 380 Konzerten pro Jahr im Großen Saal nicht 380 Sternstunden geben kann. Gelegentlich geht mal etwas schief. Bei Kaufmann kam dazu, dass eine Dame mitten ins klassische Konzert hineinrief: „Herr Kaufmann, wir können Sie nicht verstehen.“ Das war sehr ungewöhnlich und hat eine Welle an Medienresonanz ausgelöst. Dass es so ein Riesenthema in den Medien war, ist wohl eine Begleiterscheinung des unglaublichen Bekanntheitsgrades der Elbphilharmonie. Nervend ist aber schon, dass das Thema monatelang jeden Tag wieder hervorgeholt wird.
Auch durch mich jetzt. Auch durch Sie (schmunzelt er). Ärgerlich wird dann, wenn auch seriöse Medien dem Drang zur Sensation nachgeben und sich nicht einmal um ein Minimum an Recherche und Faktencheck bemühen. Denn dass die Akustik auf Plätzen hinter der Bühne nicht dieselbe ist wie davor, ist schon der Physik geschuldet. Das kann im ungünstigsten Fall dazu führen, dass Sänger vor einem großen Orchester nicht überall gut zu hören sind. Das ist aber in allen vergleichbaren Sälen von Tokyo bis Los Angeles nicht anders. Eine Woche nach dem Kaufmann-Konzert kam das gleiche Werk wieder im großen Saal zur Aufführung – zur großen Begeisterung aller Beteiligten und ohne das geringste Problem mit der Akustik.
Im Jahr 2007 wurden sie als Generalintendant der Laeiszhalle und der Elbphilharmonie berufen und erst zehn Jahre später wurde sie eröffnet. Hat Sie diese Zeit verändert? Das kann ich nicht wirklich beurteilen. In der schwierigen Bauphase mit Baustopp und den großen Streitereien war ich in gewisser Weise kollateralgeschädigt. Obwohl ich für den Bau nicht verantwortlich war, gab es viel Kritik, und ich musste gegen die schlechte Stimmung rund um die Elbphilharmonie ankämpfen. Dabei habe ich viel über Krisen-PR gelernt und mir wohl auch mehr Gelassenheit angeeignet.
Wie haben Sie das gemacht? In dem ich gelernt habe, mich über Dinge, die ich nicht ändern kann, auch nicht zu ärgern. Trotzdem habe ich da manche Feder gelassen und auch mal schlecht geschlafen. Diese Schule hat dazu geführt, dass mein Team und ich zur Eröffnung der Elbphilharmonie mit allen Wassern gewaschen und sehr gut vorbereitet waren. Das war eine irre Zeit, wir waren über Monate adrenalinbetankt – wenig geschlafen und dennoch gut drauf.
Was hören Sie privat eigentlich für Musik? Schalten Sie mit Musik ab oder suchen Sie die Stille? Es läuft fast immer Musik, weil es schon mein ganzes Leben so ist. Ich habe schon als Kind mit Musik Schularbeiten gemacht. Bei uns zuhause ist heute eher die Frage, wessen Musik dominiert. Meine oder die meiner jüngsten Tochter, die noch zur Schule geht, die beiden anderen sind schon aus dem Haus und studieren. Ich kann mich aber auch gut mitten im Trubel abkapseln und mit einer Zeitung oder einem Buch zurückziehen und mit niemanden kommunizieren. Das ist immer wieder mal nötig.
Sie sind Wiener. Was unterscheidet Hamburg und Wien anno 2019? Die beiden Städte sind zwar etwa gleich groß, aber von der Bevölkerung und der Stadtplanung her sehr unterschiedlich. Wien ist viel dichter bebaut, hat knapp zwei Millionen Einwohner auf der halben Fläche von Hamburg. Hier gibt es hingegen viel Wasser und viele Grünflächen, was ich nicht mehr missen möchte. Wien liegt weit im Osten und ist so eine Art Melting Pot für Mittel- und Osteuropa. In Wiens Innenstadt hören sie über zehn verschiedene slawische Sprachen. Wien ist mehr Metropole und strahlt das Machtzentrumsgefühl auch 100 Jahre nach Zusammenbruch des Kaiserreiches noch aus. In Hamburg hingegen ist mehr die Vernunft zuhause, eine gut dimensionierte und sehr lebenswerte Großstadt.
Was lieben Sie an Hamburg und an Wien? An Hamburg liebe ich die Weite und den Blick, das Wasser und den Menschenschlag. Ich mag die zurückhaltende Art, den trockenen Humor und die Handschlagqualität. Die liegt mir von meiner Persönlichkeitsstruktur her. Während ich die Wiener, obwohl ich selber einer bin, für nicht ganz ernst zu nehmende Balkanbewohner halte. Trotzdem macht die Wiener Lebensart, nicht alle Dinge auf die Goldwaage zu legen und sich ein wenig durchs Leben zu mogeln, es einem manchmal leichter.
Und was erwarten Sie selbst 2019/2020 von den Konzerten in der Elbphilharmonie? Viele beglückende Erlebnisse. Ich bin mit dem Publikum sehr glücklich und merke auch, dass der wiederholte Konzertbesuch von Hamburgern ein immer besseres Gefühl für die besondere Qualität im Saal zur Folge hat. Das führt bei ihnen zu einem intensiveren Konzerterlebnis als bei Gelegenheitsbesuchern. Tausende neue Konzertbesucher kommen inzwischen regelmäßig. Das ist das wirklich Befriedigende. Voll wird der Saal dank der Attraktion des Gebäudes. Aber dass sich so viele Hamburger entscheiden: So, ab jetzt gehe ich jeden Monat in ein Konzert, das ist die große Errungenschaft. Und das ist etwas, was die Stadt wirklich verändert.
Das Gespräch führte Wolfgang Timpe